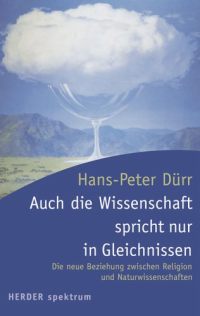Teil II Abschnitt 6 – ein Plädoyer gegen die Zwangsläufigkeit oder: das Unbehagen an der Geschichtsschreibung
Buber gibt uns ein weiteres Bild für die Ich-Es-Situation auf der einen, die Ich-Du-Situation auf der anderen Seite. Zur Ich-Es-Situation gehört die monokausale, geradlinige Zwangsläufigkeit. Buber vertieft das mit Bezug auf die Geschichtsschreibung und ähnlich arbeitende, sich selbst ideologisch limitierende, und sich dennoch als Wissenschaft bezeichnende Zugänge zur Welt der Gegenstände: „Alle Ablaufbetrachtung ist nur ein Ordnen des Nichts-als-geworden-Seins, des abgetrennten Geschehnisses, der Gegenständlichkeit als Geschichte.“
Das erinnert mich freudig an Paul Feyerabend: „Wider den Methodenzwang“ oder „Wissenschaft als Kunst,“ in denen Feyerabend unserer heutigen, sich für einzig- und allgemein gültig erklärenden Wissenschaftlichkeit die ideologische Blindheit nachweist.
Mit der (zwangsläufig ex post angesiedelten) Ablaufbetrachtung – die natürlich einen unbestreitbaren Lernwert hat – laufen wir Gefahr sehr viel abzuschneiden: den Geist, wie auch die Alternativen.
Im ersten Teil des Abschnitts versucht Buber zu erklären, was für ihn der fundamentale Unterschied zwischen Schicksal und Verhängnis (oder Zwangsläufigkeit) ist. In der Wahrnehmung der Zwangsläufigkeit führt der Weg stets von A nach B – darum herum oder dazwischen gibt es nichts (typische Ich-Es-Situation). Das ist z.B. die wundersame Welt der Schwerkraft (oder anderer physikalischer Gesetze), die natürlich ihren Erkenntniswert hat, die aber vor allem eine praktische Rechnungsgröße darstellt, die es also erleichtert, zu rechnen. Tatsächlich ergeben schon Experimente mit der Schwerkraft, dass die Dinge nicht unbedingt und nicht genau „nach unten“ fallen, sondern von allen möglichen Faktoren abgelenkt oder auch nur scheinbar abgelenkt werden können. Das existiert wohl genauso bei allen anderen derartig einfachen Versuchen, die Wirklichkeit zu erfassen und wird vom ehrlichen Physiker dann als „Schmutzeffekt“ bezeichnet. Für alle anderen existiert es noch nicht mal. Ich würde umgekehrt sagen, in diesem Sinne besteht die Welt hauptsächlich aus Schmutzeffekten – also aus Verhältnissen, die wir gerade mit keiner Formel vollständig erklären können – auch nicht mit einer Vielzahl von Formeln. Es kommt dann weiter darauf an, was wir wollen: wenn wir rechnen wollen und noch mehr Formeln (darunter stets unbestritten nützliche) entwickeln wollen, dann ist diese Beschäftigung ausreichend. Mit der Einschränkung, dass Buber sie für seelisch krank machend erklärt und dringend eine Kur in der Ich-Du-Situation empfiehlt. Zudem führt die (nahezu) ausschließliche Beschäftigung mit der Ich-Es-Situation nach meiner Beobachtung zu einem zügigen Realitätsverlust: kein Kontakt mehr („you’re out of touch, my baby ...).
Beziehung, die Ich-Du-Situation, bedeutet hingegen gerade diesen Kontakt zur Realität. Darin steckt natürlich eine anmaßende Behauptung. Was ist denn Realität ? Hier meine Erläuterung (wenn auch kein Beweis, ich geb’s zu): Ich bin mir sicher, dass die von Buber sogenannte „uneingeschränkte Ursächlichkeit“ – was ich als geradlinige A-B Kausalitätsbehauptung bezeichnen würde, nur ein sehr schwaches, eingeschränktes Bild davon gibt, wie die Dinge wirklich liegen. Dazu gibt es etwa im eingangs genannten Feld der Geschichtsschreibung viel zu sagen. Ich bin aus den gleichen Beobachtungen heraus, wie oben dargestellt, sicher, dass auch die Addition vieler solcher A-B Kausalitätsbehauptungen (die ergänzenden Formeln), nur eine u.U. bessere Annäherung, aber nie das ganze Bild bringen. Denn die Realität liegt nicht im zwei-dimensionalen (Ich-Es-Situation), auch nicht im unendlich oft addiert zwei-dimensionalen (das ist wohl das Drei-dimensionale, oder ist das schon was völlig anderes ?), mit der vierten Dimension tun wir uns schon relativ schwer – und in der Wirklichkeit schließt die Wirklichkeit alle Dimensionen ein – jedenfalls einige mehr, als wir denken können. Das gesamte, hilfsweise als „sphärische“ denkbare Umfeld, zwischen Apfelbaum, Apfel und Erdboden und alles, was im Flug passiert, was zuvor und währenddessen im Universum passiert - und noch mehr, das ist dieses allumfassende, das einhüllende Zwischen, das die Ich-Du-Situation beschreibt.
Die Monokausalität (A-B), ist die Zwangsläufigkeit, die Ich-Es-Situation, die Unfreiheit – aber auch die Irrealität, weil es sich einfach nicht um ein auch nur annähernd zutreffendes Bild der Wirklichkeit handelt. Es gibt aber auch ein Denken in Alternativen, es gibt die Möglichkeit, den Regeln ihre Allgemeingültigkeit und alles erklärende Kraft abzusprechen – es gibt vor allem die Kraft zur Umkehr.
Schicksal ist dann für Buber etwas völlig anderes als Zwangsläufigkeit: Schicksal, das Universum der Ich-Du-Situation, wird spürbar, wenn ich „die Tat, die mich meint entdecke“ und dann in ihrer Umsetzung merke, „daß ich sie nicht so, wie ich sie meinte, vollbringen kann.“ Und weiter: „Freiheit und Schicksal umfangen einander zum Sinn.“
sehen - 14. Mär, 12:34
The One Who Got Away
– übersetzt wohl "der, der mir ausgekommen ist" - Zufällig stolperte ich über dieses Erlebnis von Loren Cobb, das wohl ein gutes Beispiel für Ich-Du im praktischen Leben gibt – auf Englisch und mit eben dieser, etwas merkwürdigen Überschrift.
sehen - 12. Mär, 00:37
Nun hab ich wohl ein tolles Büchlein in der Bibliothek gefunden. Leider komme ich gerade weder zur Primär- noch zur Sekundärliteratur. Dennoch möchte ich keine Sekunde zögern, Euch dieses leider offenbar erst kürzlich erschienene und schon vergriffene Buch ans Herz zu legen – vielleicht findet Ihr es ja antiquarisch, oder in einer anderen Bibliothek:
„Zwischen Gut und Böse: mit Martin Buber sechs Schritten nach der chassidischen Lehre das eigene Leben gestalten, hrsg. Von Cornelia Muth, Gütersloher Verlagshaus 2001, 191 S. ISBN 3579023195
Prof. Muth stellt dort zunächst sehr knapp (6 Seiten) die sechs Entwiklungsschritte nach der chassidischen Lehre dar:
- Selbstbesinnung,
- Der besondere Weg
- Entschlossenheit
- Bei sich beginnen
- Sich mit sich nicht befassen
- Hier wo man steht
Danach läßt sie Buber anhand einer großen Auswahl seiner Texten neun Entscheidungswege zu den neun Leidenschaften darstellen, die da seien Zorn, Stolz, Eitelkeit, Neid, Habgier, Furcht, Unersättlichkeit, Lust und Trägheit. Ziel sei es, so der Klappentext, den Dialog mit uns selber (?!) zu entdecken. Ob Buber sich so erklären wollte, können wir vielleicht diskutieren. Die Zusammenstellung ist jedenfalls das kreative und sicher nützliche Werk der Herausgeberin.
sehen - 10. Mär, 14:25
Die drei „Todsünden“ – die eigentlich nur eine sind, nämlich Verblendung, und als solche aber wirklich als Versündigung, nämlich gegen den Geist verstanden werden können. Wer dem Geist abschwört, schwört dem Leben ab – gefährlich auch für alle Umstehenden !
Wenn man Buber im historischen Kontext sieht, sehen wir hier die von so vielen empfundene, gefährliche Leere der Zeit, die zum ersten großen europäischen Stammeskrieg geführt hat – und dann zum nächsten ...
„... keine Aufrührung der Peripherie kann die Beziehung zur lebendigen Mitte ersetzen.“ Das heißt wohl, lieber einen Monarchen, der dem Geist botmäßig ist, als eine Revolution von Dilettanten. Der Staats- oder Wirtschaftsmann, der dem Geist botmäßig ist, schwärmt nicht, sondern dient der Wahrheit. Die Staats- oder Wirtschaftsfrau – dürfen wir wohl heute ergänzen – weiss, dass sie das DU nicht rein verwirklichen kann, aber sie weiss, wo sie ist und was sie tut, sie hat ein Gespür – für den Geist, das menschliche Maß oder überhaupt, dass ihr gegenüber Menschen und andere Wesen der Schöpfung sind, denen sie sich so gegenüber verhalten kann, dass die Schöpfung weitergeht.
„Erlösung“ – das steht hier ganz klar nicht für die Beendigung des irdischen Lebens, sondern eher für eine Herauslösung aus der Geistlosigkeit, nach dem Bild des dem Lehm Geist Einhauchens. Wo wir das mit unserer Umgebung schaffen, sind wir an der Schöpfung beteiligt, finden wir auch selbst Erlösung – und stehen ganz nebenbei dem Du gegenüber.
sehen - 8. Mär, 09:29
Hier wurde ja verschiedentlich der Verdacht geäußert, Buber sei schon Es-feindlich. Er hat ja auch an anderer Stelle erklärt, warum er sich in der Verantwortung sieht, das Du zu fördern. In diesem Abschnitt schreibt er also, warum der Mensch sich um seine Haltung zum Es kümmern soll: Das Es habe die Neigung, alles zu überwuchern – Buber also, der die krebsartigen Eigenschaften des Es entdeckt hat und vor ihnen warnt, aber auch ein Gegenmittel bereit hält. Und: die dauernde, ausschließliche Ich-Es-Bezogenheit führt zu Unerlöstheit – im besten Fall sogar zu deren Wahrnehmung ...
sehen - 7. Mär, 09:19
Wieder geht Buber von einer Behauptung (Grundthese, Warnung ?) über das Verhältnis der Ich-Es- zur Ich-Du-Situation aus. Zuvor hatte er schon eine zwangsläufige ständige Verstärkung und Ausweitung der Ich-Es-Welt konstatiert. Nun meint er, die Ausbildung, der auf die Ich-Es-Situation bezogenen Funktion, erfolge (meist) durch eine Minderung der Beziehungskraft. Diese Ausbildung geht also nicht mit einer Minderung der Beziehungskraft einher, sondern sie hat diese Minderung zur Grundlage, wächst aus ihr. Die Minderung der Beziehungskaft sei Werkzeug zur Ausbildung der erfahrenden und gebrauchenden Funktion. Hmm ? Jedenfalls sehe ich den Rest des Abschnitt nicht als Erklärung dieser Behauptung – auch wenn wir selbst da intuitiv einen wie auch immer genau gearteten Zusammenhang sehen mögen. Spannend wäre halt, wie genau der beschaffen ist...
Dann weiter: Der Geist als Genußmittel – das kann wohl nicht der gleiche Geist sein, von dem Buber in Abschnitt 2 spricht.
Der Mensch- unter dem Grundwort der Trennung (eine neue Beschreibung der Ich-Es-Situation, dann die Ich-Du-Situation also als Grundwort der Beziehung) stehend – trennt sein Leben mit den Mitmenschen in Ich-bezogene Anteile (die Welt des Gefühls) und Es-bezogene (die Einrichtungen). Entscheidend hier also (wie schon in Teil 1) die Zuordnung der Gefühle nicht zur Beziehung (dem Zwischen) sondern zum Ich. Die Welt des Ichs, die Welt der Gefühle sodann als „Schaukelstuhl.“ 80 Jahre später mag man das schon als nachgerade positiv, weil gefühlsoffen, ansehen. Tatsächlich geht es um eine Beschreibung des Narzissmus – der aussichtslosen Ich-Bezogenheit. Und dann erwähnt er die Gefühle in Politik und Verbänden – erhellendes über die desaströse Rolle von beziehungsloser, narzisstischer Ich-Bezogenheit im öffentlichen Raum.
Den Menschen kennt weder das ich-bezogene, noch das es-bezogene, denn beide Situationen kennen weder das Zwischen, noch das Du. Der Sinn für Gemeinsamkeit entsteht gerade erst aus dem Sinn für das dazwischen (was eben nicht so sehr trennt, sondern verbindet) und das Du (nicht gegenüber, sondern umfassend). Ich und Es brauchen dann übrigens nichts „trennendes,“ denn sie haben nichts verbindendes. Ich und Es haben in der Ich-Es-Situation je eine Außenwand, je ihre eigene Definition, Grenze. Da muss sich also nichts trennendes dazwischen schieben: so etwas trennendes wäre in Wirklichkeit etwas verbindendes, nämlich etwas, dem Ich und Du gemeinsam anliegen.
Gefühle ohne Du sind unwirklich – auf das Ich bezogen können sie nicht wirken. Die Verzweiflung über die Unwirklichkeit der Gefühl (oder jedes andere folgende Gefühl) läßt einen unproduktiven Kreislauf entstehen.
Einrichtungen (Es-Welt) Gefühle (Ich-Welt) aufzupfropfen führt nur zu weiterer Verwirrung, nicht zu einer Verbesserung des Zustands, denn so entsteht weder (wohlverstandenes) öffentliches Leben, noch persönliches Leben. Beides entsteht nur durch Beziehung nach der Art der des Rades, das durch Speichen mit der Nabe verbunden ist, durch die lebendige Mitte. „...Gemeinde entsteht nicht dadurch, dass Leute Gefühle für einander haben (wiewohl freilich auch nicht ohne das), sondern durch diese zwei Dinge: daß sie alle zu einer lebendigen Mitte in lebendig gegenseitiger Beziehung stehen und daß sie untereinander in lebendig gegenseitiger Beziehung stehen. Das zweite entspringt aus dem ersten, ist aber noch nicht mit ihm allein gegeben.... der Baumeister ist die lebendige wirkende Mitte.“ Das metaphysische Faktum der Liebe ist, dass sich zwei Menschen das Du offenbaren. Von dort aus läßt sich auch die Ehe erneuern, nicht etwa von der Erotik, die sich auf ich-bezogene Gefühle beschränkt.
Einrichtungen und Gefühle sind also für „wahres“ öffentliches und privates Leben notwendig, geschaffen wird es aber nur von dem in der Gegenwart empfangenen zentralen Du.
sehen - 4. Mär, 09:09
Der Geist in seiner menschlichen Kundgebung ist also nicht nur Antwort, sondern wie im Abschnitt zuvor gesehen, etwas, worin der Mensch leben kann.
Der Geist ist nach Buber unabhängig von seiner Ausdrucksform, da letztere Produkt einer doppelten Brechung ist: Geist als Antwort muss sich erst im Menschen formen und dann muss diese Antwort auch noch einen äußeren Ausdruck finden.
Buber meint der Mensch lebt (steht) in der Sprache. Das ist wohl, ebenso wie oben beim Geist, der Hinweis auf die allumfassende, grenzenlose, du-bezogene Eigenschaft der Sprache, wie des Geistes: nicht wie das Blut in Dir, sondern wie die Luft um uns: ein sehr vereinigender Gedanke. Immerhin ist die Luft (wie der Geist ?!) an nationale Grenzen nicht gebunden.
„Der Mensch lebt im Geist, wenn er seinem Du zu antworten vermag ... wenn er in die Beziehung mit seinem ganzen Wesen eintritt.“ Daher also diese doppelte Eigenschaft des Geistes: der Geist ist die Antwort, die Beziehung und daher „alles“ oder allumfassend.
Je deutlicher, klarer, kräftiger aber diese Antwortseite des „Geistes,“ der Ich-Du-Beziehung sind, desto eher wird daraus auch ein sprachlicher Ausdruck – und schon wieder sind wir beim Es. Das „reine“ oder wie Buber besser sagt „freie“ Du steht da, wo der Geist sich nicht kundtut, sondern ist. Das mache das besondere Menschliche aus: dass sich für den Menschen so Erkenntnis, Werk, Bild und Vorbild entwickeln kann – „in der Mitte des Lebendigen“ – und aus ihr heraus... Das sei aber nur die eine Seite des typisch Menschlichen, dem Buber aber schon eine tragische Seite gibt. Die andere Seite sei der inhärente Aufruf, oder die immer bestehende Möglichkeit, vom Es zum Du zurückzukehren: vom Gegenständlichen zur Gegenwart.
Die Basis von Erkenntnis ist im für Buber wohlverstandenen Sinn, das Du-hafte Schauen in einem Es-orientierten Prozess der Erkenntnisvermehrung. Wer danach den „Gegenstand“ aus der begrifflichen Erkenntnis wieder herausnehmen kann, hat die Möglichkeit wieder ich das Ich-Du, also in die Gegenwart, einzutreten.
Und zum Schluss führt Buber noch das „reine Wirken, die Handlung ohne Willkür“ als höchste Ausdrucksform des Geistes ein: Die Antwort mit dem Leben. Das sein Leben sprechen lassen. Dieses Leben sei Lehre. Nicht Lehre darüber, was ist und was sein soll, sondern wie im Geist, im Angesicht des Du gelebt wird. Das führt also zurück zur Beziehungskraft, die laut Abschnitt 1 heute (bzw. vor 80 Jahren) so sehr gemindert sei.
Aha. Buber sagt, er habe keine Lehre. Vielleicht sollten wir uns doch sein Leben ansehen, soviel wir hinter den Schriften davon als Antwort auf den Geist finden können.
Dieses Leben – das erlebte Leben – ist dann möglicherweise Schlüssel zum Du und kann auch selbst zum Du werden. Wer „Bescheid weiss,“ die Welt erobert hat, alles im Buch gelesen hat, verfehlt so das Du. Verehrung und Anbetung ist etwas völlig anderes, als sich anrühren zu lassen – umfassend anrühren zu lassen.
sehen - 3. Mär, 08:46
Dieser Abschnitt endet mit einer Behauptung, in der Du, mimi23, wohl schon die deutliche Bevorzugung des Ich-Du gegenüber dem Ich-Es siehst: „Denn die Ausbildung der erfahrenden und gebrauchenden Fähigkeiten erfolgt zumeist durch Minderung der Beziehungskraft des Menschen – der Kraft, vermöge deren allein der Mensch im Geist leben kann.“
Das bleibt zunächst reine Behauptung. Wir haben zwar vielleicht das Gefühl, dass das stimmen könnte. Vielleicht wird Buber das auch in den weiteren Abschnitten von Teil II erläutern. Nach dem in Abschnitt I gelesenen kann ich das bisher nur so verstehen, dass die in der Welt der Gegenstände erworbenen Fähigkeiten dazu führen, dass wir uns in dieser Welt immer besser einrichten können und immer weniger Neigung verspüren, uns auf die Ich-Du-Möglichkeit einzulassen. So wie Buber im letzten Abschnitt von Teil I schreibt: „In bloßer Gegenwart läßt sich nicht leben ... Aber in bloßer Vergangenheit läßt sich leben, ja nur in ihr läßt sich ein Leben einrichten.“ Dieses „Einrichten“ eine typische Ausprägung der Ich-Es-Situation.
Übrigens ein paralleles Gefühl drückt wohl Fromm in „Haben oder Sein“ aus.
Wenn wir aber kritisch an Bubers Behauptung weiterdenken, werden wir prüfen müssen, was er mit „Beziehungskraft“ (der Kraft, vermöge deren allein ...) und was er mit „im Geist leben“ meint.
Im übrigen ist sich Buber bewußt gewesen, dass seine Untzerscheidung zwischen Du und Es (Sein und Haben) vielleicht etwas schwarz weiss ist. Er soll das aber mit der Erklärung gerechtfertigt haben, in einer Zeit in der das haben bestimmend sei, habe er die Aufgabe, den Primat des dialogischen Seins verstärkt und damit eben einseitig herauszustellen.
sehen - 2. Mär, 08:02
Gisela Uellenberg in Kindlers Literatur Lexikon zu Gog U-Magog (romanartige Chronik nach den chassidischen Geschichten) von Martin Buber:
... Buber verwahrt sich im Nachwort gegen die Meinung (sehen ergänzt: zur deutschen Ausgabe...), Gog und Magog enthalte seine Lehre; er habe keine Lehre. „ich habe nur die Funktion, auf solche Wirklichkeiten hinzuweisen.“ Auf den ersten Blick scheint für die „Wirklichkeit“, die Buber in diesem Werk schildert: Frömmigkeit in ihrer reinsten und entschiedensten Gestalt, in der Welt kein Raum mehr zu sein. Doch der chassidische Glaube, daß hier und jetzt dem Menschen aufgetragen sei, sich und die Welt vom Übel zu erlösen, ist modernen Heilslehren eigentümlich nahe, auch wenn das, wozu diese erlösen wollen, nicht mehr Göttlichkeit, sondern Menschlichkeit genannt wird.
sehen - 1. Mär, 23:03
Buber (1878 in Wien, am 13.06. 1965 in Jerusalem)
- der Entdecker der Zwischenmenschlichkeit
- der Erforscher der philosophisch nicht fassbaren Kategorie „Zwischen“
- der utopische Sozialist zwischen gemeinschaftlicher Gesellschaft und Staat
- der Freund (und auch Schüler) von Gustav Landauer
- der geistige Vater der Gestalttherapie
- der Übersetzer des Alten Testaments nach der besten hebräischen Überlieferung seiner Gestalt und seines Stils nach ins Deutsche (1925-1961)
- der Übersetzer und Herausgeber der chassidischen Erzählungen
- setzte sich im Sinne seines „Ich und Du“ für eine Versöhnung von Juden und Deutschen und von Juden und Arabern ein
- Wandler auf den Pfaden in Utopia und Kibbuznik.
Seine Frage ist, ob die zwischenmenschliche Kommunikation etwas mit der Kommunikation zwischen Mensch und Gott zu tun hat. Im Ergebnis bejaht er das in dem Sinne, dass diese Kommunikationen sich bedingen.
Ein paar Thesen:
- auf die Urverbundenheit folgt das sich Distanzieren, darauf die Aufnahme von Beziehung (ohne Hierarchie, ohne bestimmte zeitliche Abfolge, wohl aber zyklisch)
- das „Zwischen“ ist die Urkategorie. Begegnung, Gespräch, Dialog sind letztlich der Verfügbarkeit und Machbarkeit der Teilnehmer entzogen, denn z.B. ein Gespräch baut sich vom „Zwischen“ her auf. Die Personen treten in die Wirklichkeit der Beziehung ein, weil sie die Beziehung verwirklichen.
- So realisiert sich Zwischenmenschlichkeit durch die Menschen, wird aber durch das „Zwischen“ konstituiert.
- Du zu jemand sagen heißt: ihn anerkennen, Gemeinschaft mit ihm anfangen, das Zwischen verwirklichen ...
- Durch das gegenseitige sich Wahrnehmen der Menschen im Dialog realisieren sie das, was Buber die Wahrheit nennt: die Treue der Menschen zum Menschen.
- Deshalb gibt es für Buber vornehmlich ein Tun der Wahrheit. Mit ihm übernimmt der Mensch seine Verantwortung gegenüber dem unbedingten Anspruch des Zwischen an ihn.
Gott ist immer schon da. Er ist die ewige Gegenwärtigkeit des Du und des Zwischen. Es ist der Mensch, der in die Wirklichkeit Gottes eintreten muss; es ist der Mensch, der an Gottes Gegenwart teilnehmen muss. Allerdings nicht so, dass der Mensch über, unter oder gar jenseits der Welt Gott begegnen könnte. Gott kann der Mensch nur in der Welt, ja durch sie treffen, nicht indem er die Welt verläßt, sondern indem er sie verwirklicht.
In einer Zeit in der das Haben bestimmend sei, habe er die Aufgabe, den Primat des dialogischen Seins verstärkt und eben einseitig herauszustellen.
Unsere Quäkergesprächsrunde im Internet:
http://buber.twoday.netsehen - 1. Mär, 18:35
Warum überhaupt die Du-Welt würdigen und ganz klar erkennbar ist, dass Buber die Du-Welt sozusagen für unterbewertet hält.
Der erster Teil schließt in diesem Absatz keinesfalls mit einem flammenden Plädoyer für das Du – ich würde das auch nicht erwarten. Statt dessen weist Buber ganz nüchtern darauf hin, warum die Menschen eine zum Es haben – und alle andere Schöpfung, die eine solche Tendenz entwickeln kann, wahrscheinlich auch. Die Ich-Es-Beziehung ist existentiell nötig. In der Ich-Du-Beziehung (Buber sagt: „in der Gegenwart“) läßt sich nicht leben. Er geht sogar soweit zu sagen, nur in der Vergangenheit ließe sich ein Leben einrichten.
Allerdings ist schon zu hören, dass Buber Zweifel daran trägt, ob Leben dazu da sein, eingerichtet zu werden. Ganz klar ist er darin, dass wer mit dem Es allein lebt, sei nicht „der“ Mensch – was ich so verstehe, dass er wesentliche Eigenschaften des Menschlichen verfehle, oder zumindest das Potential nicht erreiche.
Ein sehr schöner „Spruch des Tages“ sicher:
„Man braucht nur jeden Augenblick mit Erfahren und Gebrauchen zu füllen, und er brennt nicht mehr.“
Ich kann besser mit den Dingen leben, die mehr Frage, als Zufriedenheit hinterlassen !
Damit ist also Teil I vorbei. Es folgt Teil II und III sowie das Nachwort vom Oktober 1957. Mag jemand anders vielleicht den nächsten Teil übernehmen ?
sehen - 28. Feb, 08:50
Buber beschreibt wieder das Unbeschreibbare. Es ist nicht eine Zusammenfassung, sondern wir begegnen wieder neuen Aspekten der Wahrnehmung, der Gegenwart, des Du. Oder Bildern. Mit ihren inhärenten Widersprüchen. Ich will hier jetzt gar nicht näher darauf eingehen, obgleich oder gerade weil es mir relativ einfach zu sein scheint, über diesen Abschnitt zu reden - unter der Voraussetzung der vorangegangenen wohl - und eigenem Erleben.
Bei aller Kritik und Interpretation müssen wir natürlich immer sehen, dass es hier definitionsgemäß um das Unbeschreibbare geht. Gleichzeitig soll es nicht „Esoterisch“ sein – wobei die Behauptung allein, dass es sich um die Welt handele, wie sie jedem Menschen in seinem einmal und immer wieder begegne, also um „die Wahrheit“ natürlich nicht das Verbot von Hinterfragen – sowohl der Wahrnehmung als auch der Worte enthält. Spannender als dies ist aber die Frage an uns: was kannst Du sagen – oder: wie würdest Du das ausdrücken. Die Sprachdichte von Buber ist sicher nur eine Möglichkeit unter vielen und es gibt viele andere, die sich mit gleichen Wahrnehmungen befaßt haben. Offenbarung scheint mir übrigens ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang.
Und ich glaube nicht, dass die Welt des DU wichtiger ist, ich verstehe es nicht so, dass sie für Buber „wichtiger“ sei. Sie ist aber. Und sie ist nach Buber zwingende Voraussetzung der Begegnung mit Er/Sie/Es und vorher noch für die Herausbildung des Ich. Und wir können viel Kraft aus der Ich-Du-Situation schöpfen.
sehen - 25. Feb, 08:58
Das Ich wird entdeckt – oder eher: es entsteht – wo das Du schwindet. Das Du der Beziehung verblaßt immer wieder und es entsteht dann ein Gespür für das, was dann immer noch da ist und „nach dem Du langt und es nicht ist.“ Das Ich ist also zunächst das aus der Beziehung, was da ist, wenn das Du nicht mehr da ist. Das Gespür für das Ich wird immer stärker, bis es einmal sich selbst einen Augenblick wie einem Du gegenübersteht. Damit ist es sozusagen aus der Schale geschlüpft. Es gewinnt durch den Vorgang oder die (unbewußte ?) Beobachtung Leben und Form, dass das Du verblassen kann, ohne zum Es zu werden. Es kann einfach im Nichts versinken oder unbeachtet sein, bis zu einem neuen Beziehungsereignis.
Das entdeckte oder (selbständig) gewordene, vom Du abgelöste Ich ist nun selbst nicht mehr unbegrenzt, kommt dabei aber in die Lage, ein „erfahrendes und gebrauchendes Subjekt“ werden zu können. Damit wird die Ich-Es-Beziehung möglich: ein sich mit Forscherblick vor den Dingen aufstellen (nicht ihnen gegenüber). Die Dinge fangen an, sich aus der Summe ihrer Eigenschaften aufzubauen. Zu diesen Eigenschaften gehört auch ihr räumlich-zeitlich-ursächlicher Zusammenhang.
Zum Du gehört die Zeitwahrnehmung als „Weile.“ Zum Du gehört, dass alles (Ich und Du sind bereits „alles“) wirkt und Wirkung empfängt. Zum Es gehört der Zeitabschnitt und die lineare Folge Ursache-Wirkung. Das Du kennt kein Koordinatensystem. Erst das Es wird koordinierbar.
Aber, so Buber: „Die geordnete Welt ist nicht die Weltordnung.“ Letztere kann in Augenblicken geschaut werden (Du) und in die Erkenntnis (Es) des Menschen eingehen. Strahlen der Kraft der Weltordnung dringen in die geordnete Welt (des Es) ein und schmelzen sie immer wieder auf (zum Du). Das bezieht Buber wiederum ausdrücklich auf die Individualgeschichte und auf die Menschheitsgeschichte.
sehen - 22. Feb, 09:18
Sich alles zum Du machen: nicht Erfahrung eines Gegenstandes, sondern Auseinandersetzung mit einem echten Gegenüber. Das Gesprächmit dem brodelnden Teekessel.
Das sind für mich spannende Stichworte aus dem, wie Buber hier nun individualgreschichtlich, also am Beispiel des sehr jungen Menschen, von vor der Geburt bis zum Krabbeln vielleicht, sein Bild vom Ich und Du erläutert.
Das Beziehungsstreben sei das erste, die aufgewölbte Hand, in dies sich das Gegenüber schmiegt (ein schönes Barlach Bild) - nun ich bin mir da nicht sicher, was zuerst ist. Auch Buber sieht, die vielfältige Geborgenheit des kleinen Menschen lang vor einem "Streben." Aber wo er vom "eingeborenen DU" schreibt, würd ich ihm gleich wieder recht geben. Es gibt, meint er wie ich ihn verstehe, eine naturnotwendige bei und vor der Geburt vorhandene Begabung mit Beziehungsfähigkeit, weil jeder Mensch in diese Beziehung Ich-Du hineingeboren wird. Und andererseits jeder Mensch wohl auch zum Ich und Er/Sie/Es kommt - aber später. Die physische Geburt ist ein konzentriertes Abbild des gesamten Ich/Du/Er/Sie/Es Prozesses. Das Ich entsteht dann vielleicht auchgar nicht so sehr, sondern manifestiert sich eher ?
sehen - 19. Feb, 11:55
Erneut beginnt ein ganz kurzer Abschnitt mit einer Frage. Sehen wir hier ein besonderes Beispiel für das dialogische Prinzip ? Buber will seinen ganzen Text in Zwiesprache oder Beziehung zum Leser schreiben. Ich denke also, dass der Abschnitt mit expliziter Frage und Antwort eher daran erinnern soll, den Leser also ähnlich einem Hörer daran erinnern soll, ruhig Zwischenfragen zu stellen – und dass sie auch beantwortet werden: manchmal sofort und schriftlich, manchmal nur geistig.
Der „Dialog“ zeichnet sich wohl dadurch aus, dass auch die explizite, schriftliche Antwort dem nicht Leser nicht einfach als endgültige Erklärung vorgesetzt wird. Sowohl Frage, als auch Antwort werfen ihrerseits neue Fragen auf – regen also wirklich den Dialog (weiter) an und schließen (glücklicherweise) nicht ab.
Buber fragt sich an ein Paradies in der Urzeit der Menschheit – oder läßt sich danach fragen. Es geht also nicht um einen jenseitigen Zustand, sondern ganz konkret unter Menschen, wenngleich zu einer anderen Zeit. Unterstellt wird der Begriff des Paradieses und Buber weist wie in den vorangegangenen Abschnitten auf den Entwicklungsaspekt (Urzeit…) hin. Das verbindet er bemerkenswerterweise mit der Glaubensfrage.
Zumindest hinsichtlich des Glaubensaspektes ist vielleicht die Frage schon ironisch gemeint, jedenfalls greift die Antwort sie skeptisch auf: Buber beantwortet sie mit Vorsicht hinsichtlich seines Wissens – übrigens selbst so noch nicht mit genug Vorsicht, meine ich. Er meint also, auf eine gewisse Urzeit in (seinem) geschichtlichen Denken zurückgehen zu können. Er kann oder will nicht einschätzen, ob diese solchermaßen für ihn doch fassbare Urzeit nun als Paradies oder als Hölle zu qualifizieren war (obgleich ihm wohl mehr für letzteres zu sprechen scheint). Er ist sicher aber sicher, dass diese Urzeit nicht „unwirklich“ war.
Was meint Buber an dieser Stelle mit „unwirklich“ ? Er meint wohl zu wissen, dass die Urzeit „Präsenz“ hatte oder Realität war, für die damals lebenden Menschen. Dann kommt ein drastischer Ausspruch: „…aber besser noch Gewalt am real erlebten Wesen, als die gespenstische Fürsorge an antlitzlosen Nummern! Von jener führt ein Weg zu Gott, von dieser der in Nichts.“
Unwirklich ist also „gespenstische Fürsorge an antlitzlosen Nummern,“ während das Gegenteil und (noch, also relativ gesehen) besser die „Gewalt am real erlebten Wesen“ sei. Klar also, dass heute – zumindest in Bubers heute, auch in unserem? – vorrangig die „gespenstische Fürsorge an antlitzlosen Nummern“ zu beobachten ist.
Oh je. Ist das so ? Ich kann über so etwas nicht sprechen oder nachdenken, wenn nicht erstmal zumindest geklärt ist, was Gewalt ist. Ich selbst definiere sie in etwa als Ausübung physischer oder psychischer Kräfte mit der Wirkung, die (nicht ihrerseits gewalttätigen) Lebensentfaltungsmöglichkeiten einzuschränken. Ob Gewalt nach so einer Definition etwas auch nur vergleichsweise positives hat, wage ich zu bezweifeln. Von dem Gegenbild der „gespenstische Fürsorge an antlitzlosen Nummern“ weiss ich auch recht wenig – ich hoffe, Buber hält mich da nicht für blind. Allerdings gebe ich zu, dass sie wohl existiert (was genau aber ist „gespenstisch“ außer einer starken Abwertung ?) – insoweit aber sicher eine Art der Gewalt nach meiner Definition ist. Sollte Buber von einer ähnlichen Gewaltdefinition ausgehen, liegt also der Unterschied nicht im je ersten Teil des Vergleichsgegenstandes, sondern darin, dass die Gewalt (in der Urzeit) am real erlebten Wesen ausgeübt wurde, heute an antlitzlosen Nummern. Letzteres führe ins Nichts, ersteres möglicherweise („ein“ Weg) zu Gott.
Ist das die erste Stelle in dem Buch, in der das Wort „Gott“ gebraucht wird ? Kommt mir so vor. Nun wird hier sogar gleich auf einen Weg zu Gott hingewiesen. Über das Begegnungserlebnis, auch über die Gewalt – wenn sie nur am real erlebten Wesen ausgeübt wird – führt ein Weg zu Gott. Vielleicht mal ein Test im kleinen: die Hausschlachtung führt zu Gott, abgepackter Pressschinken führt ins Nichts. So richtig will ich mich darauf nicht einlassen. Interessant bleibt aber, dass es
- einen Weg zu Gott gibt,
- einen Weg gibt, der nicht zu Gott führt,
- der Weg von Gott weg ins Nichts führt,
- also das Nichts seinen Platz hat
- und der ist am gegenüberliegenden Ende von dem Gottes.
Hmm – das ist wohl nicht beziehungsvolles Lesen. Vermutlich will Buber etwas anderes sagen. Ich wehre mich gegen das was da steht und verschließe mich wohl gegen das was er sagen will. Aber was ist es ?
sehen - 18. Feb, 09:29