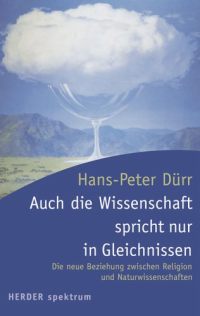Aber das Hören enthält andere Möglichkeiten, eine andere Kraft in sich als dieses bei sich zu bleiben und eine vertraute Welt um sich herum aufzubauen. Luigi Nono hat das in seinem Vortrag "Der Irrtum als Notwendigkeit" von 1983 angedeutet: " Die Stille. Hören ist sehr schwierig. Sehr schwierig, in der Stille dien Andern zu hören. Andere Gedanken, andere Geräusche, andere Klängen, andere Ideen. Wenn man hören kommt, versucht man oft, sich selbst in den Andern wiederzufinden. Seine eigenen Mechanismen, System, Rationalismus wiederzufinden, im Andern. Statt die Stille zu hören ... Das ist eine Mauer gegen Ideen, gegen das, was man heute noch nicht erklären kann ... Man liebt es, immer wieder dasselbe zu hören, mit jenen kleinen Unterschieden, welche erlauben, die eigene Intelligenz zu beweisen ..."
Das Hören also als Annehmen des Unvertrauetn, des Neuen, des Fremden, als Überschreiten der eigenen Grenzen, ja als Weg in die Freiheit! Es fällt auf, daß der Text von Nono mit dem Hinweis auf die Stille beginnt. Stille ist doch das Unhörbare - mit welchem Recht kann sie ein Vorwort zum Hören sein? Nun ist es eine sicher auch Nono bekannte Tatsache, daß es, wenn Menschen beteiligt sind, Stille gar nicht geben kann. Das war die Erkenntnis von John Cage, der sich, um Stille zu erleben, in den schalltoten Raum der Harvard-Universität begeben hatte und selbst dort zwei Lauten, einem hohen und einem tiefen, begegnete: dem Geräusch des Blutkreislaufs und der Bewegung der Nerven. Solange Leben präsent ist, gibt es keine Stille; es hat seinen Sinn, daß man Stille mit Friedhofsruhe assoziiert.
Weil Hören ein Phänomen des Lebens ist, kann es also im genauen Sinn gar kein Hören auf die Stille geben. Stille kann deshalb keine Lautlosigkeit um mich herum sein, sondern musß als innere Stille verstanden werden, als eine Qualität des geistes, der mit nichts beladen ist, nichts wünscht und erwartet, sondern offen ist für das, was immer kommen mag. Stille in diesem Sinn ist gleichbedeutend mit Empfangsbereitschaft. Anders als im spekulativen Hören, in dem der Geist, was ihn schon erfüllt, in Beziehung setzt zu demwas ihm jetzt begegnet, ist der stille Geist eine leere Projektionsfläche, auf dem sich das, was jetzt geschieht, ohne Modifikationen abzeichnen kann. Nur so kann das Andere, von dem Nono spricht, das Fremde und Unvertraute, in Erscheinung treten, denn es ist nichts da, an das es sich anpassen müßte oder das das Fremde ergreift und sich zu "eigen" macht; so kann der Geist Neues erfahren.
aus Thomas Ulrich "Reines Hören" in Lettre International 66 (Herbst 2004) S.102
sehen - 17. Feb, 13:45
Ich glaube, an diesem 12 Zeilen kurzen Abschnitt kann man ganz gut demonstrieren, was Buber lesen heißt, oder heißen kann.
Nach dem ersten Mal durchlesen, würde ich sagen, ist der Abschnitt auf Anhieb unverständlich. Also: Buber kann und will nicht auf Anhieb verständlich sein. Zum einen behauptet er, von dem zu sprechen, das teils kaum in Worte zu fassen ist. Zum anderen will er in der Ich-Du-Beziehungssituation sprechen – d.h. es kann sein, dass (er oder) der Leser die Ebene gerade verfehlt und diese Kommunikation scheitert, aber auch nicht auf einer anderen Ebene stattfindet.
Ausweg 1, den ich sehe, also: mit möglichst großer Ruhe und Entspanntheit Wort für Wort aufnehmen, sich an all das erinnern, was Buber bereits zuvor gesagt hat und die Resonanz, die es bei einem gefunden hat, sehen, was Buber „meint.“ Das ist kein „wissenschaftliches“ Verfahren, d.h. es ist mit dem Risiko behaftet, dass ich einerseits vielleicht genau den „Sinn“ finde, den Buber meinte, oder andererseits weit daneben liege – und weder erkennen noch erklären kann, was von beiden es ist und wie ich da hingekommen bin.
Ausweg 2, der auch möglich ist, ist die Bemühung mit klassischen Methoden der Textarbeit, den Text zu entschlüsseln. Vielleicht läßt sich auch Weg 1 und 2 ein Stück weit verbinden, wie auch Archäologen auch auf Intuition – will sagen: Wahrnehmung und nicht nur Analyse dessen, was der Kopf bekanntes wiederentdeckt - angewiesen sind.
Buber beginnt diesen Abschnitt also mit einer Frage, woher die Schwermut unseres Loses kommt. Woher diese Frage kommt, ergibt sich nicht, auch nicht aus den vorangegangenen Abschnitten, denn da ist zwar von Entwicklung die Rede, als dem „woher,“ aber nicht vom Los oder von Schwermut. Die Frage ist also angefüllt mit Unterstellungen, ruft also nach Gegenfragen, bzw. der Reaktion: „oh, Du empfindest also ein „Los“ und siehst dies mit Schwermut verbunden ...“
Statt sich aber auf einen derartigen Dialog einzulassen, weist Buber selbst die Frage gleich teilweise zurück und bestätigt nur den Entwicklungsaspekt – wie er sich eben auch aus dem vorangegangenen Abschnitt ergibt. Er bestätigt das aber nicht einmal wirklich, da er „wohl“ und „insofern“ sagt. „… insofern das bewußte Leben des Menschen ein urgeschichtlich gewordenes ist:“ das ist eigentlich gar keine Antwort, denn wir wissen nichts über das bewußte Leben des Menschen und ob bzw. gar inwiefern es ein urgeschichtlich gewordenes ist. Im darauf folgenden Satz behauptet er (geschickt mit dem Wort „nur“ verstärkt), die Individualentwicklung sei nur ein Abbild des Seins ins Gesamt („welthaft“) in Gestalt eines menschlichen Werdens. Interessanter Gedanke: ein (wohl scheinbares) Werden emuliert ein Sein. Nächstes Sprung – zum Geist und der Zeit. In der Tat ist der Zeitfaktor bzw. dessen Illusion in dem vorangegangenen angelegt. Der Satz könnte also additiv beginnen: „Auch der Geist...“ – das wäre allerdings falsch im Buber’schen Sinne, da es sich beim Geist eben nicht um etwas abgetrenntes handelt. Also wäre der letzte Satz dieses Absatzes auch etwa so zu lesen: „Alles und seine imaginären Teile erscheint in dem, was man für Zeit hält, als Zusammengesetztes und Entstandenes, als Ausgeburt oder Nachgeburt der Natur – richtiger ist die Natur aber eingefaßt – aber ohne strikte Abgrenzung von dem Ganzen und ohne dass der zeitliche Aspekte dabei ein Rolle spielt.“
Und dann geht Buber weiter und behauptet im zweiten Absatz dieses Abschnitts, dass der Gegensatz der Ich-Du zur Ich-Er/Sie/Es-Situation (den beiden Grundworten …) schon immer war (zeitlos ist bzw. „der Schöpfung inhäriert“ – inhärent: wörtlich „einhängend“ also soviel wie zugehörig), auch wenn er in unterschiedlichen Zeiten, Kulturen und Sprachen unter vielen verschiedenen Namen auftreten mag.
Also, dieser Abschnitt läßt sich mathematisch, grammatisch und kontextuell sicher noch weiter und besser auslegen. Nach meinem Eindruck würde ich sagen: ja, er hat seinen Zusammenhang, ist keinesfalls sinnlos oder unsinnig, wie es beim ersten Lesen erscheinen mag. Seine tiefe Bedeutung, die den Leser weiter tragen soll, erschließt sich mir nicht – dafür reibe ich mich hier zu sehr an Behauptungen. Die können erst wieder versöhnt werden, wenn ich weiterlese und merke, wie Buber es „eigentlich“ und kurzgefaßt meint – das ahne ich natürlich auch schon vor dem Hintergrund des bereits gelesenen...
Vielleich läßt sich ein Hauch von Dreieckbeziehung aufbauen, wenn das Du der Du-Baumbeziehung so be-geist-ernd dem Du der Ich-Du-Beziehung erzählt, dass eine Brücke entstehen kann, so dass eine Beziehung entsteht zwischen dem anderen Du und dem Baum.....aber das geht nur, wenn man davon ausgeht, dass sich die Aktualität, die Gegenwart der Beziehung nicht in einer limitierenden Zeit-Raum-Wirklichkeit abspielt, sondern alles ausfüllend ist. Aber vielleicht spricht genau das dagegen. Und wo ist dann das ewige Du?
Interessant finde ich, dass die Voraussetzung für die Ich-Er/Sie/Es- Beziehung die Werdung des Ichs duch Ich-Du-Beziehung ist. Buber spricht später sehr verdammend von denjenigen, die in Ich-Es-Beziehungen nur den Gebrauchswert sehen. Das sind für ihn diejenigen, die in keine Ich-Du-Beziehungen eintreten (können). Es gibt also viele Arten der Ich-Es-Beziehung, und sie unterscheiden sich in ihrer Qualität enorm auch in ihrer Wechselwirkung auf die Ich-Du- Beziehung.
sehen - 17. Feb, 13:27
Buber bezieht sich auf wiederum auf entwicklungsgeschichtliche Erkenntnisse, wonach sowohl bei „primitiven „Völkern,“ als auch eben in der Individualentwicklung zunächst nur das „Grundwort“ Ich-Du, als die Ich-Du-Beziehung oder –Situation existiert. Bemerkenswert ist, dass aus Bubers Sicht die ganz klar ohne eine Trennung zwischen Ich und Du auskommt – es gibt nämlich gar kein wahrgenommenes Ich. Es gäbe ich dieser Situation („Beziehungsereignis“) „nur die zwei Partner, den Menschen und sein Gegenüber, in ihrer vollen Aktualität...“ Ein bißchen schwierig zu erklären ist dabei, dass es in dieser Situation (es handelt sich nicht so sehr um einen Zeitpunkt ...) kein wahrgenommenes, separates oder separierbares Ich gibt – denn das ist erstmals noch gar nicht „hervorgetreten.“ Andererseits, das sagt Buber an dieser Stelle nicht ausdrücklich, scheint mir aber für das Verständnis sehr wichtig: in der Ich-Du-Situation gibt es eben generell kein separates Du: die Ich-Du-Situation ist alles, füllt alles aus ...
Dann erst (entwicklungs- bzw. individualgeschichtlich) lernt der Leib sich selber kennen und unterscheiden – daraus wird Ich und das erste Es. „...das hervorgetretene Ich erklärt sich als den Träger von Empfindungen, die Umwelt als deren Gegenstand.“ Damit entsteht das Ich und das Er/Sie/Es etwa gleichzeitig – allerdings ist das erste Er/Sie/Es ein Teil des Körpers oder der Körper selbst ...
Dann kommt Buber zu dem Satz: „Ich sehe den Baum.“ Er weist daraufhin, dass dieser Satz eine Bezeichnung der Ich-Du Situation zum Baum erzählen kann, ebenso aber auch eine Bezeichnung der Ich-Er/Sie/Es-Situation zum Baum. Das würde ich dahingehend ergänzen, dass von der Ich-Du-Sutuation zum Baum wohl kaum berichtet werden kann, ohne sie verlassen zu haben und daher letztlich gar nicht oder allenfalls mehr oder weniger unvollständig und unverständlich – vielleicht ist aber ein Erzählen von der Ich-Du-Situation zum Baum „Ich sehe den Baum“ doch möglich, nämlich innerhalb einer weiteren Ich-Du-Situation zu einem anderen Menschen. Es ist mir also vorstellbar, eine Ich-Du-Situation zu einem Menschen aufrechtzuerhalten und erzählend einen Baum vorsichtig miteinzubeziehen, ohne die Ich-Du-Situation zum einen wie dem anderen zu verlassen. Geht das ?
sehen - 16. Feb, 09:22
Oh je, hier wird es komplex. Beziehung, so meint Buber, sei frueher als gegenstand. Das hatte er schon individual-entwicklungsgeschichtlich erklaert, jetzt erklaert er es sozial-anthropologisch. Beginnend mit dem all-umfassenden getragen sein, wird erst das erleben der wirkung bewusst, dann wird es von einem selbst abgetrennt und auf ein Objekt
uebertragen, das dann mit mannigfaltigen eigenschaften ausgestattet werden kann und gegenstand von wissen wird. Das sei ein vorgang, der sich aus dem erregungsbild ergibt, das die beziehung hervorruft. In diesem erregungbild ist die „wirkung“ das, was fuer den erhaltungstrieb das wichtigste und fuer den erkenntnistrieb das merkwuerdigste sei.
Daher sei es nicht „alles,“ etwas, das spuren hinterlaesst, sondern
gerade die „wirkung.“ Das bedeutet fuer uns, dass beziehung nicht haupsaechlich durch ihre wirkung charakterisiert wird. Wir koennen aber am ehesten die wirkung „unterscheiden“ und befinden uns damit natuerlich sofort wieder aus der welt der ich-du beziehung heraus in die welt der ich-er/sie/es-beziehung. Erst aus vieles solchen begegnungen, in denen aus dem du mit seinen unendlich vielen gestalten ein er/sie/es mit seinen typen wird, entsteht auch das ich, als der „gleichbleibende“ partner der wechselnden beziehungen. Buber spricht von gleichbleibend. Ich meine, dass das ein relatives gleichbleiben ist. Nach dem, was wir wissen, wird das ich doch in der du beziehung immer wieder so stark gepraegt, dass es sich nicht um ein gleichbleibendes handeln ich kann. Ich glaub, letztlich so aehnlich auch in den anderen beziehungen, nur eben in geringerem masse.
Zum urspruenglichen Selbst-Erhaltungstrieb, zur Schoepfung und
Fortpflanzung gehoert nach Buber kein Ich, sondern ein Er/sie/es. Was die spannende Frage gibt, ob es nicht auch viele Beziehungen von er/sie/es zu er/sie/es geben muss – oder hab ich da was falsch verstanden ?
sehen - 11. Feb, 12:52
Aus SAID
In Deutschland Leben
Ein Gespräch mit Wieland Freund
Beck 2004
S. 27
besonders erinnere ich mich an eine kleine faszinierende geschichte von heinrich böll, „an der brücke.“ sie handelt von einem kriegsheimkehrer, der an einer brücke autos zählen soll. jeden tag nun kommt seine „ kleine geliebte“ vorbei, aber er kann sie nicht mitzählen. sie läßt sich doch nicht einfach so addieren, multiplizieren! damals hielt ich diese geschichte für sehr iranisch und gar nicht für deutsch. die art wie der ich erzähler seine geliebte vor zahlen, statistik und allem öffentlichen schützt, kam mir sehr iranisch vor.
sehen - 9. Feb, 02:54
Wunderbar, sich diese Wortkombination auf der Zunge zergehen zu lassen: wenn Beziehung sich ausgewirkt hat, wird das DU zum Er/Sie/Es. Und es läßt sich überhaupt nicht vermeiden, dass sich Beziehung „auswirkt." Zunächst gehört es zwar nur zu ihrer Definition, dass das Du am anderen Du (Ich) wirkt. Wenn sich dieses Wirken aber manifestiert (hat) und materialisiert hat – verwirklicht hat (!), ist diese Manifestation/Materialisierung/Verwirklichung beschreibbar und insofern ein Gegenstand außerhalb der Ich-Du Beziehung.
Ein von Buber genanntes Beispiel ist ein Kunstwerk – es gibt natürlich noch ein paar weitere naheliegende Gegenstände der „Schöpfung.“ Die Ich-Du-Situation ist mit diesem „Auswirken“ nicht zwingend insgesamt zu Ende – die Beziehung selbst hat sich an dieser Stelle aber aus-gewirkt – wirkt also nicht mehr auf das gleiche Ziel weiter. Das „Ver-“ in „Verwirklichung“ steht charakteristisch für das Ende, „das darüber hinaus.“
Buber schreibt: „Am Werk bedeutet Verwirklichung im einen Entwirklichung im anderen Sinn.“ und weiter: „Und die Liebe selber kann nicht in der unmittelbaren Beziehung verharren; sie dauert, aber im Wechsel von Aktualität und Latenz.“
sehen - 2. Feb, 09:07
Auch hier hat Buber Beobachtungen gemacht, die zwar nicht gerade Allgemeingut geworden sind, aber doch von vielen geteilt werden. Ich glaube er sagt in etwa: Das Gegenteil von Liebe ist die Beziehungslosigkeit. Buber sagt übrigens nichts direkt darüber, was das „Gegenteil“ von Liebe ist. So etwas kann es im Wortsinn nicht geben. Selbst Vakuum paßt als Gegenbegriff wohl nicht richtig - und schon gar nicht „Gleichgültigkeit.“
Buber hätte wohl gegen Gleichgültigkeit gar nichts einzuwenden, vor allem, soweit es sich nicht um eine Haltung der ständigen Bewertung aller Dinge – wenn auch als gleich – handelt, sondern um eine Frage der (zeitweisen) Emotionalität. Für ihn kommt es eher auf das Sehen und die Beziehung an.
Ja, in diesem Abschnitt bringt er die Liebe doch in Beziehung zum Sehen: Liebe, wie er das Wort benutzt, ist nie blind, während Hass stets blind ist. Genauer sagt er, solange die Liebe nicht das ganze Wesen sieht, gibt es noch nicht die Ich-Du–Beziehung. Hass aber sieht nie das ganze Wesen. Der Hassende sieht immer nur einen Teil des Wesens.
„Wer ein ganzes Wesen sieht und es ablehnen muss, ist nicht mehr im Reich des Hasses, sondern in dem der menschenhaften Einschränkung des Dusagenkönnens... entweder den anderen oder sich selbst ablehnen zu müssen: das ist die Schranke, an der das In-Beziehung-treten seine Relativität erkennt und die erst mit dieser aufgehoben wird.“ Es ist also aus zahlreichen Gründen nicht praktisch zu erwarten, dass ich mit allen oder allem eine Ich-Du-Beziehung eingehen kann. Ich darf mir zugestehen, dass ich nicht DU sagen kann – und dabei den anderen auch ganz sehe. Ich kann andererseits zwar einen Teil des anderen sehen und ihn hassen. Dann aber sollte ich wissen, dass es mehr an diesem gehassten Wesen gibt und ich mit meinem Hass weder ihm noch mir „gerecht“ werde, sondern in einem mehr oder weniger bewussten Zustand der Blindheit verharre, aus dem ich gelegentlich rauskommen sollte, um nicht mir und anderen zu schaden.
„Doch der unmittelbar Hassende ist der Beziehung näher als der Lieb- und Haßlose,“ schreibt Buber am Ende des Abschnitts. Es geht ihm natürlich um die konkrete Beziehung zum konkreten Objekt des Hasses, nicht um die Lieb- und Hasslosigkeit im Allgemeinen. Ich kann jetzt nicht ganz verstehen, warum der Hassende der Beziehung näher sein soll, als der Haßlose. Ich verstehe das vielleicht in Hinsicht auf den Lieblosen, wenn Lieblosigkeit in einem bestimmten Verhältnis zu Liebe steht. Wenn man bei beiden Worten von dem gleichen Begriff der Liebe ausgeht, wäre Liebe also z.B. „beziehungsnah,“ das ganze Wesen sehend, lieblos demzufolge der gewählten Definition gemäß beziehungsfern und nicht das ganze Wesen sehend. Der Hassende ist dann aber möglicherweise genauso beziehungsfern sein. Zumindest sieht auch er nicht das ganze Wesen.
Ich halte es jedenfalls nicht für zutreffend, zu schließen, auch der „nicht Hassende“ (in diesem Sinne Haßlose) sei beziehungsfern. Das ganze erhellt sich nicht stärker, wenn man annimmt, Buber meine den, der gleichzeitig lieb- und haßlos ist. Allerdings klärt sich an dieser Stelle wohl ein Stück weit auf, weshalb „Liebe“ nicht schon „Beziehung“ ist, nicht identisch mit Beziehung ist: Beziehung bedeutet für Buber wohl das „aneinander wirken.“ In der Ich-Du-Beziehung steht dieses aneinander Wirken unter dem Vorzeichen des umfassenden Sehens des DU – was dann die Liebe bedeutete. In dem „unmittelbaren Hassen“ kann wohl immerhin einiges vom „am anderen wirken“ stecken – freilich nicht in Gegenseitigkeit, also m.E. auch nicht in „Beziehung.“ Nach all dem bleibt mir also fragwürdig, wie diese „Beziehungsnähe“ des „unmittelbar Hassenden“ aussehen soll. Vielleicht hat sich Buber selbst als Hassender „beziehungsnah“ gefühlt. Andererseits hat der Abschnitt und besonders der Satz mit geholfen, genauer zu verstehen, dass Beziehung, Liebe und die Ich-DU-Situation nicht identisch sind.
sehen - 1. Feb, 09:21
Hier bedeutet Gegenseitigkeit nun nicht das materialistische, konditionale „do ut des,“ eher schon „gib, so wird dir gegeben.“ Es ist also zwangsläufig: wo und wie ich wirke, wirkt mein Gegenüber (und sei es ein Baum) an mir. Buber nennt noch Beispiele, die wir alle kennen: Kinder, Schüler, Tiere.
Spannend, wenn er schreibt: „Der ‚Böse‘ wird offenbarend, wenn ihn das heilige Grundwort berührt.“ Da steckt wohl drin, dass es
a) einen ‚Bösen‘ in dem Sinne nicht gibt – sonst wär er nicht in Apostrophen gesetzt.
b) er auch nicht seinen Charakter verändert, sondern eher offenlegt (offenbarend wird) und anfängt „mitzuwirken,“
c) wenn das DU ihn erreicht – nun, wozu wiederum zwei gehören – einer, der das „Du“ spricht und eben ‚der Böse,‘ der sich doch berühren läßt – zwei selten zusammentreffende Bedingungen.
sehen - 31. Jan, 09:21
Tja, da hätte doch beinahe jeder gedacht, Liebe sei ein Gefühl.
Sich verlieben ist ein interner Vorgang, spielt sich bei einem selbst ab, ist ein Gefühl vergleichbar mit anderen Gefühlen, die man so hat. Und das große Leiden, das oft mit dem sich Verlieben einhergeht, kommt gerade daher, dass es definitionsgemäß nichts mit inneren Vorgängen bei dem Geliebten oder gar mit "Beziehung" zu tun hat. Ich leide daher, wenn ich genau dies endlich bemerke und ich mich folgerichtig aber immer noch ich-verhaftet in meinem Ich verletzt, enttäuscht, zurückgewiesen fühle. Dabei gab es keine Grundlage "Beziehung" oder überhaupt irgendetwas anderes zu erwarten. Wenn zwei sich gleichzeitig ineinander verlieben wird es eigentlich noch gefährlicher – und es scheint mir nicht sicher, dass die Chance auf eine Beziehung wächst.
Liebe, abgegrenzt von diesem Gefühl des Verliebtseins, ist etwas völlig anderes. Sie ist, um mit dem offensichtlichsten anzufangen, schon mal nicht solchen Schwankungen unterworfen, wie (alle) Gefühle das sind. Sie ist offensichtlich sehr stark auf den anderen bezogen, wenig auf mich.
Buber beschreibt das in diesem Abschnitt sehr gut. Danach ist Liebe ist nicht im Menschen angesiedelt, sondern findet zwischen den Menschen statt. Er schreibt: "Gefühle Werden 'gehabt;' die Liebe geschieht. Gefühle wohnen im Menschen; aber der Mensch wohnt in seiner Liebe."
Dabei sei Liebe ein welthaftes Wirken. "Glaub an die schlichte Magie des Lebens ... die Wesen leben um dich her, und auf welches Du zugehst, du kommst immer zum Wesen."
Liebe war für mich bisher die umfassendere Form des Sehens. Buber fügt dem noch ein paar Dimensionen hinzu. Nach Buber ist Liebe doch etwas wenigstens zweiseitiges. Liebe ist Beziehung – damit weit mehr als Sehen. Er erklärt dann die „Ausnahmen“ damit, dass „Du“ mehr weiss als „Er/Sie/Es.“ Liebe ist Wirken – auch das ist mehr als Sehen. Liebe ist nicht esoterisch, sondern welthaft, das heißt für mich einerseits „global/allumfassend“ andererseits diesseitig/konkret. Es braucht keine andere „Magie,“ als die bereits ständige wirkende, des Lebens. Sich da einzuklinken heißt schon in seiner Liebe zu wohnen. Oder ?
sehen - 28. Jan, 12:43
Hier kommt wohl eine Auseinandersetzung mit Platon, der den Glauben an die reale Existenz der Ideenwelt, etwa die Idee des „Tischs an sich,“ verbreitet hat. Buber nimmt das auf und gesteht den Ideen ihre Existenz zu. Sie sind für Buber, wie ich ihn verstehe so sehr existent, wie alles andere in dieser Welt, mit der Folge, dass ich mit diesen Ideen ebenfalls in einer Ich-Er/Sie/Es-Situation sein kann (Normalfall), oder mit einer in eine Ich-Du-Situation (Beziehung) treten kann.
Buber meint, dass einer, der ausschließlich in Ich-Er/Sie/Es-Situationen lebt, in der Welt der zu gebrauchenden und zu erfahrenden Gegenstände, leicht einen sinnstiftenden Überbau in der Welt der Ideen suchen wird – um den Mangel an Beziehung auszugleichen. Ohne eine Ich-Du Beziehung zu der Idee ändert sich aber gar nichts: auch mit dem Überbau wird er in der Ich-Er/Sie/Es-Situation verharren.
Buber betont, dass es ihm keinesfalls um den „Menschen an sich“ und auch nicht um die „Idee vom Du,“ das „Du an sich“ geht – sondern um sein gelebtes Leben und die Ansprache des Du im Leser. Er redet „von Dir und mir.“
sehen - 27. Jan, 09:18
Folgendes Buber Zitat und weiteren Text fand ich in dem Artikel von Reichert (links unter Buber und Freunde). Bubers "Ich und Du" erhebt den Anspruch in dialogischer Haltung geschrieben
zu sein. Das ist hoch gegriffen (Text und Praxis sind selten nah beieinander) und ein ungewöhnlich spannender Test, denn der Leser tritt damit zwangsläufig in eine Beziehung ein. Welche genau das ist, hängt sicher von vielen Umständen ab. Ein "Beweis" ist damit also nicht verbunden. Interessante Überlegung: Beweise gehören wohl sicher nicht in den Bereich der Ich-Du Situation ...
Hier also der Text:
"Ich zeuge für Erfahrung und appelliere an Erfahrung. […] Ich sage zu dem, der mich hört: ‘Es ist deine Erfahrung. Besinne dich auf sie, und worauf du dich nicht besinnen kannst, wage, es als Erfahrung zu erlangen.’" (Antwort, S. 593) – "Letzten Endes appelliere ich […] an das wirkliche und mögliche Leben meines Lesers. Die Intention meiner Schriften ist wirklich eine ganz intim dialogische." (Brief an Malcolm L. Diamond vom 19. 9. 1957; Briefwechsel Bd. III, S. 438)
Für die Buber-Lektüre bedeutet dies: Man muss immer diese Intention im Blick haben. Wenn man sich auf die Begriffe und eine Analyse ihrer Bedeutung konzentriert und so die Bedeutung der Texte zu fassen versucht – ein bei philosophischen Texten normalerweise sinnvolles Verfahren –, wird man Buber nicht verstehen bzw. missverstehen. Jochanan Bloch (Die Aporie des Du) kennzeichnet Bubers Sprechen als Sprechen in "Ab-stoßworten" (S. 223), das in seinen Begriffen das Gemeinte nicht wirklich begreifen könne; diese Worte zeigten lediglich in eine Richtung, man müsse sich von ihnen "je-weils in die wortlos zu vergegenwärtigende Gegenwart abstoßen" (ebd.). Wer mit der Buber-Lektüre beginnt, etwa mit seinem grundlegenden Buch Ich und Du, sollte nicht versuchen, jeden Satz zu verstehen (eine begriffliche Bedeutung festzulegen) und sich daraus im Verlauf des Lesens Stück um Stück die Bedeutung des Ganzen zusammensetzen. Es ist vielmehr wichtig, Sätze "unver-standen" (nicht eingeordnet) stehenlassen zu können und weiterzulesen; der "Sinn" des Ganzen ist eigentlich in jeder Aussage enthalten, aber das einzelne ist nur von diesem Sinn her verständlich. Man kann dieser Paradoxie bei Buber nicht entgehen.
sehen - 26. Jan, 09:44
Gegenstände umstehen einen. Die Ich-Er/Sie/Es-Situation bedeutet, dass man von Inhalten umstanden ist, in der Vergangenheit lebt, präsenzlos ist . Gegenstände stehen still und gehören – ebenso wie die entsprechende Erfahrung der Vergangenheit an. Sie bestehen im Gewesensein.
„Gegenwart ist nicht das Flüchtige und Vorübergleitende, sondern das gegenwartende und Gegenwährende.“ Gegenwart ist nicht der Endpunkt der abgelaufenen Zeit, sondern die unbegrenzte, wirkliche Gegenwärtigkeit des mir gegenüber leibenden Dus. Gegenwart währt also.
Das erinnert mich an ein Rezept gegen das Älter werden (wenn man denn die Kraft dazu findet): Alte Menschen leben ja sehr offensichtlich in der Vergangenheit. Wir erleben sie also besonders alt und besonders der Vergangenheit verhaftet, wenn sie so gar keinen Anteil mehr an der „Gegenwart“ nehmen – also besonders wenig Ich-Du Beziehung aufnehmen. Wir wissen auch, dass das schon relativ jungen Menschen passieren kann. Also: Anregung an uns selbst
sehen - 25. Jan, 08:56
So geht die alte fernöstliche Weisheit und Buber greift sie hier auf: Das Du wird nicht durch Suchen gefunden.
Das Du begegnet mir. Es begegnet mir von Gnaden. Ich begegne ihm aber auch. Es ist also kein passiver Vorgang – sonst wäre es keine Beziehung. Begegnung ist nicht etwas, was „passiert.“ Auch wenn sie nicht gesucht werden kann. Sie muss aber gefunden werden. Wenn ich suche, will ich etwas haben. Ich bin auf etwas bestimmtes aus. Das ist etwas abgegrenztes, sonst könnte ich gar nicht danach suchen. Es handelt sich also um ein Er/Sie/Es. Darum kann ich das Du nicht suchen. Und darum paßt der Satz „Wer suchet, der findet nicht“ zumindest auf die Suche nach dem Du. Zum Finden muss ich aber offen sein für die Begegnung, mich aktiv bereit machen. Das ist ein ganz anderer Vorgang als das Suchen. Beim Finden umarme ich, was mir begegnet. Beim Suchen lass ich alles liegen, bis ich das in der Hand halte, was ich vorher im Kopf hatte – ein Vorgang ohne Begegnung/Beziehung.
Allerdings kann der zumindest mir recht lästige Vorgang des Suchens angenehm werden, wenn ich mich dafür öffnen kann, mich auch mit ganz andere Sachen zu befassen, solchen, die ich nicht gesucht habe: da finde ich wieder was. Auch da ist wieder der Unterschied zwischen Suchen und Finden zu sehen.
Übrigens gibt es eine Geschichte über Pippi Langstrumpf – ich glaub die, die mir am besten von allen gefallen hat – da bezeichnet sich Pippi als „Sachensucherin.“ Das was sie dann vorführt und beschreibt ist aber genau das nicht. Pippi sucht gar nichts und findet dabei die tollsten Sachen, buchstäblich indem sie über sie stolpert.
sehen - 23. Jan, 17:24
Roswitha Jarman bezog sich auf Buber in einem Vortrag, den sie am 30.10. 2004 beim XII. Ökumenischen Forum im Ökumenischen Zentrum St. Stephanus zum Thema „Auf Gewaltopfer hören“ hielt. Deshalb will ich die Passage zitieren (alle Hervorhebungen von Roswitha Jarman):
„... so versuche ich, auch diesen aufflammenden Hass als Teil einer Hilflosigkeit zu verstehen, der wir mit unserem Hören begegnen können. Wenn die Qualität unseres Hörens tief ist, wenn wir in dem anderen den Bruder, das du, erkennen, dann können wir hoffen, dass auch der Hass eine Transformation erleben kann.
Auf Gewaltopfer hören, das heißt für mich auf beide, Täter und Opfer, zu hören. Es heißt eine Beziehung zu dem Menschen, mit dem wir im Gespräch stehen, aufzunehmen, im anderen das zu erleben, und so zu wissen, dass wir Teil eines Ganzen sind, und ich möchte hinzufügen, dass wir Teil einer heiligen Welt sind.
Das i c h braucht das d u, so wie das d u das i c h braucht. In so einer wahren Begegnung ist Gottesgeburt möglich.
Ich möchte mit einem Buber Wort schließen, wer mit Gott reden will, muss die Welt umarmen. Unsere Umarmung darf nicht begrenzt sein auf das Liebenswerte und Schöne, wir müssen bereit sein, die Welt, so wie sie ist, zu umarmen. Wenn wir so auf Gewaltopfer hören, reden wir mit Gott.“
Dazu fällt mir noch ein, dass es in vielen Situationen klar ist festzustellen, wer Täter und wer Opfer ist. Es gibt andere Situationen, wo das nicht immer so leicht. Manchmal sind sie auch beides (ohne dass das identisch wäre), manchmal ist der isoliert betrachtet klar als Täter auszumachende Beteiligte nach anderer Betrachtung das klare Opfer. Dabei geht es mir nicht so sehr um „Entschuldigung“ oder auch nur um Erklärung – ich will viel mehr einen weiteren (sicher nicht den gewichtigsten) Grund liefern, warum es Sinn macht, mit Tätern und Opfern zu sprechen, und nicht nur mit der einen Seite.
sehen - 22. Jan, 23:43
Buber stellt die Wechselbeziehung zwischen dem Künstler, seinem Objekt und dem Kunstwerk dar, um daran das Wesen der Beziehung zu beschreiben.
„Die Gestalt, die mir entgegentritt, kann ich nicht erfahren und nicht beschreiben; nur verwirklichen kann ich sie.“ Er sagt: „ Indem ich verwirkliche, decke ich auf. Ich führe die Gestalt hinüber –in die Welt des Es. Das geschaffene Werk ist ein Ding unter Dingen, als eine Summe von Eigenschaften erfahrbar und beschreibbar. Aber dem empfangend Schauenden kann es Mal um Mal leibhaft gegenübertreten.“
Das Objekt der Kunst, wie Buber sie versteht, ist also keine Ausgeburt der Phantasie oder der Seele des Künstlers, auch nicht bloss ein Ding, sondern ein Du. Es ist ein Du, das so aktiv ist, dass es „leibhaft gegenübertreten“ kann und mit dem Künstler um Verwirklichung ringen kann. Dieser Prozess des Ringens ist ein intensiver Prozess von Beziehung, die bedeutet, dass das Du an mir wirkt wie ich an ihr wirke (... nur anders ...).
Wenn dieses Ringen aber mit der „Verwirklichung“ zu Ende gekommen ist, steht da (auch) ein Es. Das Du existiert weiter, aber es ist nicht gleichzusetzen mit dem Kunstwerk, mit dem Ergebnis der Verwirklichung.
Bemerkenswerterweise kann aber auch das Kunstwerk, dieses Ding, zu einem Du werden, zu einem neuen Du, das natürlich nicht identisch ist mit dem, was sich in dem Kunstwerk verwirklicht hat. Das passiert dem „empfangend Schauenden.“ Da geht eine neue Beziehung los, die wiederum mehr beinhaltet, als das Ich und das Du – den Betrachter und das Kunstwerk. Wieder beginnt dieses Ringen, das zu dem ersten Kunstwerk geführt hat. Das Ringen ist natürlich nicht gewalttätig – aber „wirksam.“ Vielleicht einer Geburt vergleichbar. Ein interessanter Vergleich übrigens, denn mit dem Abschluss der Geburt ist ja auch plötzlich ein neues Er/Sie/Es da, das zuvor ein Du in absoluter Beziehung war – und in neuer Beziehung wieder zu einem Du werden kann ...
Wie schön !
sehen - 21. Jan, 15:47