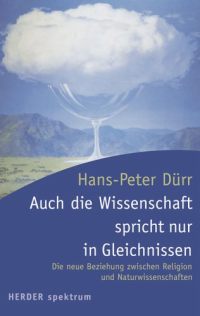Das wesentliche Element in einer Beziehung – ein Gefühl, dann auch noch Abhängigkeits- oder Kreaturgefühl. Interessant, dass Buber diese von ihm zitierte Anschauung nicht sogleich weit zurückweist, erscheint es doch fraglich, ob Gefühle wirklich das wesentliche Element einer Beziehung sein können – und dann vor allem Abhängigkeitsgefühle. Aber ja, doch: wir hatten es ja gelesen: ohne Du kein ich. Schon da eine offensichtliche Abhängigkeit. Und mehr noch so natürlich im Schöpfungszusammenhang. Aber, so Buber, das sei eben bei weitem nicht alles. Also – was ist es noch, das die „vollkommene Beziehung“ charakterisiert ?
Dann zunächst etwas zu den Gefühlen. Sie hätten alle ihren Platz in einer jeweils bestimmten polaren Spannung. Sie vollziehen sich in der Seele. Soweit anders als und nicht Teil von Beziehung, die zwar auch zwischen ist, aber auch soviel drum herum einschließt, dass es wohl mehr als eine polare Spannung sein wird (na vielleicht doch einem Magnetfeld vergleichbar ?). Anders aber jedenfalls die absolute Beziehung, die alle relativen einschließt und sie alle vollendet. Dort gäbe es – anders als die Behauptung der Psychologen, die tiefe Religion auf ein abgegrenztes Gefühl reduzieren - kein solch abgegrenztes Gefühl – und vielleicht die Auflösung der polaren Spannung ?
Ja, so ist dann wohl der dritte Absatz zu verstehen. Die Seele, das Sinnesorgan für Gefühle, nimmt die vollkommene Beziehung zwar noch bipolar wahr, aber als Coincidentia Oppositorum – wo also die Polen zusammenfallen. Wenn sie zusammenfallen überdecken sie sich auch – kein Wunder, dass dann der eine nicht gesehen werden kann - laut Buber aufgrund der jeweiligen religiösen Grundeinstellung: er geht also davon aus, dass mit dieser religiösen Grundeinstellung Gott gesehen werden kann, aber nicht das Ich – da bin ich mir nicht sicher ... Vielleicht will er aber sagen, dass die religiöse Grundeinstellung oft überhaupt verhindert, Gott zu sehen. Das könnte ich viel eher verstehen, ist aber nicht leicht öffentlich zu vermitteln ...
Und nun geht es mit der direkten Ansprache des Lesers los: „Du...“ Unvermittelt wird nun das kreatorische Gefühl auch noch eingefügt – folgerichtig, wenn wir an das Zusammenfallen der Pole denken und dazu erinnern, dass es sich um ein Gefühl handelt – einen Begleitumstand in der Seele (?!). Interessant, dass er „Du hast Dich ... gefühlt“ sagt.
Im nächsten Absatz Rhetorik: weißt Du nicht, dass Gott Dich braucht... Das Bild von einem Gott, der Dich (und mich) braucht. Nein, Hinweise aus dem Erleben einer Gottesbeziehung und einem langen Ringen um diese Beziehung. Alles, was hier steht ist nicht vorstellbar, nicht einmal sagbar ohne das Bewußtsein, der Sicherheit dieser Beziehung. Gott braucht Dich zu eben dem, was der Sinn Deines Lebens ist. Nein, Gott gebraucht Dich nicht, Gott braucht Dich. Ah, hier wird Schöpfung wirksam – Beziehung, was sie eigentlich bedeutet, wahrnehmbar.
Beziehung zum Baum, ich will dahin noch mal zurückgehen, das ist nicht ein Gefühl der Verliebtheit in den Baum und oh, wie ist er schön und gibt auch keine Widerworte. Die Beziehung zum Baum war eher die Wahrnehmung mit allen Sinnen und das wirken lassen, wie der Baum an mir wirkt wie ich an ihm (nur anders). Buber sagte, Beziehung ist auch, wenn die eine Seite gar kein Bewußtsein dafür hat. Beziehung wirkt. Ich kann auch an dem anderen arbeiten, ohne es selbst zu merken. So – und noch viel mehr – sind wohl die Sätze über die Schöpfung zu verstehen, an der wir teilnehmen. Wir müssen teilnehmen, es ist unser Schicksal. Wir können uns so verhalten, dass wir ihm nicht gerecht werden, aber aussteigen können wir nicht.
Opfer heißt: „Dein Wille geschehe.“ Wenn Buber fortfährt „…durch mich, den Du brauchst…,“ meint er wohl nicht diejenigen, die herrschen wollen und sich vordrängen, Bischof zu werden, Kanzler oder was auch immer… Das sind wohl die, die Magie üben, Künste im Leeren. Wahre Beter und Opferer sind die, die das Du Wort sprechen und vernehmen. Sie vernehmen ihrerseits das Du – bishin zur Anrede durch Gott – das gebet wird erhört. Beziehung besteht aus „Vernehmen“ – dem Vernehmen mit allen bekannten und unbekannten Sinnen…
Und dann wird die Spannung aus dem Anfang des Abschnitts aufgelöst: die reine Beziehung ist nicht als Abhängigkeit zu verstehen. Das Gefühl ist da, ja, es führt aber in die Irre. Hier wohl wieder eine relativ deutliche Kritik an dem, was üblicherweise mit „religiöser Grundeinstellung“ verknüpft wird.
sehen - 10. Aug, 22:00
Es gibt also einen Du-Sinn beim Menschen. Dieser Sinn strebt seinem Ewigen Du zu. Kann der Sinn vom Mensch getrennt sein ? Buber sagt weiter oben wohl, dass Gefühl und Mensch durchaus nicht eins seien. Sinn und Mensch sind zwar nicht ein und dasselbe, aber ich sehe nicht, wie sie sich trennen lassen könnten. Kann der Sinn allein/selbst streben ? Vielleicht, wenn wir ihn als die Essenz des Menschen verstehen, das was nicht träge zurück bleibt.
Aus den Beziehungen zu allem einzelnen Du widerfährt diesem Sinn eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung ist eine Klärung, ein Schritt näher zur Wahrheit – nichts verwunderliches also an dieser Stelle. Spannender das Wort „widerfährt“ – das bedeutet wohl, der Sinn erleidet etwas, gegen das er sich nicht wehren kann und was seine Richtung verändert. Es ist dann wohl diese Enttäuschung, die ihn seinem ewigen Du zu streben läßt. Über die Beziehungen zu allem einzelnen Du hinaus aber nicht hinweg. Statt hinaus, paßte „hindurch“ besser zu dem Linien-Bild. Auch hier wäre der Schwerpunkt falsch gesetzt, wenn wir uns an hinaus und hindurch zu lange aufhalten würden. Entscheidender scheint mir das Wort „alle“ zu sein – alle im umfassenden und gleichzeitigen Sinn, ist wohl gemeint – die Synästhethik oder Zusammenwahrnehmung, wie es beiläufig so schön hieß ...
Streben ist nicht suchen, auch das ist klar. Und diesem klaren Etwas stellt Buber dann wieder eine große, eher schwer zu fassende Einsicht zur Seite. Das scheint mir Bubers Rhetorik zu sein: immer wieder mit dem klaren und einfachen zu beginnen, das jeder kennt und dem jeder zustimmen kann. Dann schreibt er also weiter, es gäbe „in Wahrheit kein Gottsuchen, weil es nichts gibt, wo man ihn nicht finden könnte.“ Da steht nicht: Gott ist überall oder Gott ist in/hinter allem, Gott ist versteckt, oder man kann Gott finden. Da steht eher, ich könnte ihn überall finden. Ob ich ihn denn irgendwo finde, steht auf einem völlig anderen Blatt (dem der Beziehungen…), und hat wenig mit der Suchbewegung zu tun. Ich glaube, es hat doch etwas mit einer Suchbewegung zu tun, wenn die nämlich gleichzusetzen ist mit dem Streben des Beziehungssinns über alle die Beziehungen zu allem einzelnen Du hinaus. Nein, das können wir gleich wieder verwerfen, denn streben ist nicht suchen, wie oben schon als banal festgestellt. Vor allem aber sagt Buber mit diesem Satz explizit, dass man nicht suchen kann, wie nach etwas, das nicht zu sehen ist, das nicht da ist, das sich versteckt hat, das verloren ist ... all das ist Gott genau nicht. Das Wort Suchen erweckt also so völlig falsche Assoziationen, dass es für diese Zwecke gleich abgetan werden kann.
Das Streben wird dann weiter sehr schön erläutert: „...wie wenn einer seines Weges geht und nur eben wünscht, es möchte der Weg sein...“
„Gewärtig, nicht suchend, geht er seines Weges;“ da steckt das Warten drin – wiederum die Achtsamkeit (guardare). Gelassenheit und Berührung – das entspringt aus der Gewärtigkeit, das schafft Beziehung, das hilft. Gefunden hat er, wenn er über alles hinaus, aber nicht hinweg ist, dann ist sein Herz dennoch dem Einzelnen nicht abgewandt...
Der Weg ist Finden – nicht Suchen. Die alte asiatische Weisheit: wer suchet, der findet nicht, ist daher zwar nicht direkt falsch, aber auch nicht richtig – also keine Weisheit. Dieses Finden, von dem hier die Rede ist, hat nichts mit Suchen zu tun. Suchen verhindert Finden nicht absolut – aber Finden kommt sicher nicht vom Suchen, eher vom frei sein vom Suchen.
Gott läßt sich weder mittels Deduktion noch mittels Induktion beweisen – er läßt sich überhaupt nicht beweisen. Er ist nach Buber weder „Teil von,“ noch gibt es etwas anderes, dass Teil von ihm wäre, er steckt nicht in... und etwas anderes steckt nicht in ihm. Er „ist“ nur und ist damit nicht „aussagbar“ (beschreibbar, definierbar, möglicher Gegenstand einer Aussage) – aber ansprechbar. Wunderbar !
sehen - 26. Jul, 15:03
Die Ich-Du-Situation, die Beziehung, ist ausschließlich. Sie füllt den Himmelskreis. Was aber schließt sie damit aus ? Nichts, erstmal. Aber auch alles: nämlich alles Es. Es gibt kein Es mehr in der Ich-Du-Situation. Alles tritt in den Licht-Schein der Beziehung und „erscheint“ in ihrem Licht. Damit besteht aber noch nicht zu allem was sonst ist in der Welt eine Ich-Du-Beziehung. Eher zu nichts, was sonst noch in der Welt ist. Sie füllt also den Himmelskreis (Sphärenbild), aber nicht im Sinne eines Einschließens, sondern im Sinne eines Ausschließens. So verstehe ich das jetzt jedenfalls.
Dann behauptet Buber, diese „Weltweite“ der Beziehung erscheine als Unrecht an der Welt, sobald das Du wieder zum Es geworden ist. Ist das so ? Wem erscheint sie so ? Weltweit heißt dann wohl nicht, dass die Ich-Du-Beziehung in der Welt „global“ sei, sondern dass sie dick und fett sei und sich über die ganze Welt lege. Eigentlich gibt es die ganzen anderen Es noch, aber sie sind aus dieser Ich-Du Beziehung ausgeschlossen und erscheinen nur noch in ihrem Licht -–bis zum unwiederruflich nahenden Ende dieser Ich-Du-Beziehung.
Nun meint Buber, anders als bei der Beziehung zu einem „weltlichen Du“ seien in der Beziehung zu Gott „unbedingte Ausschließlichkeit und unbedingte Einschließlichkeit eins.“ Die Beziehung zu Gott (zum ewigen Du ?) entsteht also mit der Ich-Du-Beziehung zu Allem, oder aus der Ich-Du-Beziehung zu Allem wird die Beziehung zu Gott. Soweit erscheint mir das nicht neu und überraschend. Ein spannender Punkt ist aber wieder die Aussage: „Gott in der Welt“ – das ist Es-Rede. Umgekehrt wird wohl ein Schuh draus – aber etwas schwer in Begrifflichkeit zu fassen. Wir sind sicher am Ende der Begrifflichkeit.
„Wer alles Weltwesen ihm zuträgt, findet ihn, den man nicht suchen kann.“ Dazu soll man mit dem ganzen Wesen zu seinem Du ausgehen. Auf jeden Fall steckt da drin, dass man bloß das Wesen ganz lassen soll. Man findet Gott auch nicht, wenn man aus der Welt ausgeht. Das ewige Du ist immerhin schon zu sehen, zu finden, wenn man durch das Du und alle Du‘s hindurchschaut – hinter ihnen, im Schnittpunkt der Linien. Damit bekommt das Bild von den Schnittpunkten für mich ein neues Verständnis: Erst aus den mehreren, eher vielen, am besten unendlich vielen gleichzeitigen Beziehungen zu DU’s dieser Welt kann ich den Schnittpunkt hinter ihnen ausmachen, kann ich Gott finden. Erst wenn bzw. sobald oder solange ich mit allem Einzelnen in der Ich-Du-Situation stehe, bin ich in der Beziehung zu Gott.
Und noch ein paar weitere wunderbare Buber’sche „Hinweise“ auf Gott.
sehen - 19. Jul, 09:04
Es geht um den Weg zum Anderen hin. Das ist mein Anteil. Sein Wegstück zu mir hin, dass ist aus seiner Sicht sein Anteil, aus meiner Sicht Gnade, aber nicht ein Teil von mir – auch dann nicht, wenn wir uns wirklich begegnen, wenn wir in Beziehung treten. Es geht hier also nicht darum, dass jeder „seinen Weg allein gehen muss.“ Sondern ob ich auf den anderen zugehe, ob ich überhaupt gehe, das ist mein Anteil. Eine wirklich große Verantwortung. Ob der andere einen Weg geht und ob wir gemeinsam in Beziehung treten können liegt danach nicht mehr bei mir. Wohl aber liegt es bei mir, ob ich selbst in die Beziehung eintrete. Es ist wohl nicht meine Schuld, wohl nicht einmal meine Verantwortung, nicht immer etwas was woran gearbeitet werden kann oder muss - aber doch ein Teil von mir.
Ein neuer Begriff von Beziehung: Aktion des ganzen Wesens, die alle Teilhandlungen soweit aufhebt, dass aus Aktion der Passion ähnlich wird. Wir kommen in den Bereich des Buddhismus, habe ich den Eindruck: die allumfassende Tätigkeit des ganz gewordenen Menschen (Beziehung) ist das Nichttun, nicht mehr eingreifen, sondern wirken und bewirkt werden – in der Beziehung eine wirkende Ganzheit werden. „In dieser Verfassung Stetigkeit gewonnen haben heißt zur höchsten Begegnung ausgehen können.“
Es geht nicht aus der Welt zu treten, auch nicht aus der Scheinwelt – denn es gibt nur eine Welt. Es geht aber darum das Abgetrenntsein abzutun – nicht es zu überwinden, sondern es „einfach“ abzulegen. Dieses Ausgehen ist nicht lehrbar - Buber lehrt nicht – es ist nur aufzeigbar – das ist es, was Buber mit diesem Buchg bezweckt: aufzeigen, hinweisen…
Im Gegensatz zur Mystik, so Buber, käme es auch nicht darauf an, das „Ich“ aufzugeben (ohne Ich keine Beziehung, keine Begegnung), sondern nur einen Drang, sich vor der Beziehung in das „Haben“ der Dinge zu flüchten. Diesen Drang nennt Buber Selbstbehauptungstrieb. In diesem Ausdruck ist sicher die „Behauptung“ zu betonen und im übrigen gehört er wahrscheinlich zur Definition der „Eigenwesen“ des II. Teils. Die Welt der Beziehung kennt keinen Halt, sie hat keinen Grund, da sie keine Grenzen hat. Das bedeutet Unsicherheit – kein Wunder, dass wir Angst davor haben !
sehen - 17. Jul, 22:15
Hier kommt eine Erläuterung zu dem Du, das seinem Wesen nach nicht Es werden kann (vgl. Abschnitt 1): Buber meint, wie schon ausführlicher in seinen Evolutionsmutmaßungen in Teil 1 gezeigt – dass früher die Ich-Du Situation vorherrschte. Diese bezog sich (auch) auf das ewige Du: in der direkten Ansprache und dem Lobgesang. Ein Name, die Beschreibung (auch wenn es 1000 sind), führt eigentlich zum Es. In diesem Abschnitt reisst Buber aber an, wie sich das beim ewigen Du anders verhält. Die Menschen sind zwar getrieben, ihr ewiges Du als Es zu bedenken (bedenken steht in der Ich-Es Situation), oder zu bereden (ebenso das „bereden“ – das darüber reden – auch eine der Paradoxien, mit der wir es hier zu tun haben). Sie mögen aber noch soviel bedenken und bereden, nicht nur bleibt das ewige Du unser ewiges Du, die Ich-Du Situation bleibt damit erhalten und sogar die Namen sind und bleiben heilig, da sie in der Beziehung waren, sind und dort wirken.
Das kann auch uns allerhand sagen: es ist überheblicher Unfug (sich) verbieten (verweisen) zu wollen, das Wort Gott zu gebrauchen. Es kann nicht mißbraucht werden, vor allem wird es durch seinen Gebrauch nicht schlechter, sondern allenfalls wichtiger. Irr-Rede über Gottes Wesen und Werke wiegt nichts, da sie zum Bereden gehört. Jede Rede über Gott steht in er Es-Situation zu einem, das nicht Es sein kann, sie ist für uns nötig, aber auch unmöglich, ändert aber an dem ewigen Du nichts. Es kommt nach Buber auch nicht darauf an, welche Vorstellungen jemand, der wirklich Gott anredet, von ihm hat. Wenn er ihn wirklich anredet, hat er du im Sinn. Es entsteht sofort Beziehung, denn das Du in seiner Allumfassendheit ist schon da.
Und dann die spannende logische Schlussfolgerung aus dem Vorgesagten: auch wenn jemand nicht Gott ansprechen will, nicht an ihn glaubt oder ihn haßt, tritt in die Beziehung zu genau diesem einen, allumfassenden, ewigen Du ein, wenn er „sein“ allumfassendes Du, das Du seines Lebens anspricht. Das ist der Monotheismus schlechthin – und entspricht dem, was ich mir schon lange vorstelle. Das kann es übrigens auch sehr erleichtern „Gott“ zu sagen, oder auch „Herr“ oder „Herrgott“ – wenn das hilft. Das Wort wird von uns meist ohnehin im Bereden verwendet und muss dann dazu dienen, Kommunikation unter uns zu ermöglichen – sehr schwer aber nicht unmöglich. Jeder Name, der sinnvolle Kommunikation unterstützt, ist dann recht. Und wenn wir das Du anreden, kommt es auch nicht auf den Namen an – solang nur Du gemeint ist !
sehen - 16. Jul, 19:40
Der erste Absatz besteht aus einem einzigen Satz: „Die verlängerten Linien der Beziehungen schneiden sich im ewigen Du.“ Das lehrt mal wieder Buber Lesen, habe ich den Eindruck: ich habe für mich versucht, den Satz grafisch umzusetzen. Zum einen war ich aber nie gut in Mathematik, zum anderen will sich Buber wohl nicht auf diese Art verstanden wissen. Jedenfalls habe ich es aufgegeben.
Ich konnte immerhin erkennen, dass Buber von mehreren Beziehungen spricht. Die Schwierigkeit in der Umsetzung liegt für mich aber schon darin, dass jedes Ich auch ein Du ist (OK, am Anfang des Buches stand, das müsse nicht immer so sein, aber es ist wohl eher die Regel als die Ausnahme – immerhin sprechen wir von Beziehung). Zum anderen paßt das Linienbild natürlich nicht gut zu dem Sphärenbild.
Das ist für mich nun schon ein erster Erkenntnisgewinn über das, wovon Buber spricht und ich muss zugeben, ich habe jetzt doch schon mal eine Runde weitergelesen und bin bis Abschnitt 7 gelangt. In den folgenden Abschnitten, auf die ich mich schon sehr freue, wird das vertieft, habe ich den Eindruck: es ist das eine (Linie) und/oder das andere (Sphäre). Nur das eine wäre falsch, ebenso nur das andere, aber auch „und“ bzw. „oder“ allein trifft es nicht ...
Es geht also „quasi“ um einen Raum („Sphäre“), der auf einen Punkt konzentriert ist (DE), von ihm ausgeht und auf ihn zurückführt, der die Dimensionen übergreift und in unseren Dimensionen nicht zu fassen ist.
Dann finden wir hier einen interessanten Satz über das ewige DU: es zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht Es werden kann. Ich habe den Eindruck, das wird ein Stück weit in den nächsten Abschnitten modifiziert – also mal sehen.
Das Linienbild wird im zweiten Absatz weiter verständlich gemacht und da kommen wir wohl zu Kernbestandteilen von Bubers Menschen- und Gottesbild, die sich von der Idee des „von Gott in jedem Menschen“ wohl nicht im Ergebnis, aber ganz sicher auf den Ebenen davor deutlich unterscheiden.
Jedes Du ermöglicht einen Durchblick zum ewigen DU. Das heißt, es ist nicht Teil des ewigen Du. Das Wort Durchblick bedeutet natürlich einerseits „Verständnis,“ weist im Bild das Buber gebraucht aber viel stärker auf so etwas wie Röhre, Schacht, Kanal hin. Man könnte also einerseits sagen, da wo man mit Blick auf das dem Ich gegenüberstehenden Du nichts sieht (obgleich man da eigentlich ALLES sieht), dort also, sieht man dann wirklich alles (nämlich das Ewige DU). Angesprochen sind also wieder eine Reihe von Paradoxien: Erfülltheit und Unausgefülltheit, Körperlichkeit und Schlüssellochleere, ein Durchblickschlüsselloch, das aber keinen Schlossmechanismus hat, keine Drehen im Schloss ermöglicht, das Nichts im Alles, das den Blick auf Alles ermöglicht – und all das auch nicht ...
Dann das Wort vom eingeborenen Du. Nur syntaktisch erschließt sich mir, dass das nicht das ewige sein kann (sondern das jeweils gegenüberstehende). Es verwirklicht sich an einer Beziehung, vollendet sich an keiner. Spannend ist, dass sich das eingeborenen Du nicht in einer Beziehung verwirklicht (weder in der Sphäre noch vermöge der Linien). Hingegen vollendet sich das eingeborene Du in der unmittelbaren Beziehung zum ewigen Du. Es vollendet sich – nicht: „es wird vollendet vom ...“ Und hier doch: in der Beziehung.
sehen - 15. Jul, 09:18
Buber baut hier ein Bild vom Sehen (OK – auch vom Horch_en...) auf, das mir ähnlich kräftig wie das Höhlengleichnis erscheint. Einerseits ist es wieder ein neues Bild für das, was er schon in den vergangenen Abschnitten versuchte zu sagen. Andererseits bleibt es ausfüllungsbedürftig und weist, nehme ich an, schon auf Teil III.
Elemente sind das Denken und das Fühlen, das Gerade und das Runde, das Eine und das Ganze. Jedenfalls ist der Gedanke in der Lage schöne, auch beruhigende Bilder zu malen. Sie helfen ein bißchen weiter, vor allem helfen sie über die Panik des Alltag hinweg. Zur Wirklichkeit führen sie aber nur, wenn man alle Gedankenbilder ohne Zeit und Raumbezug auf einmal sehen kann.
Buber wird etwas drastischer in der Ausdrucksweise. Ich bin gespannt auf Teil III, den ich noch nicht kenne, von dem ich andere hab sagen hören: oh, jetzt klinkt er aus. Nun, mal sehen, ob wir auch ausklinken, oder in unserer Art zu lesen, doch was darin finden.
sehen - 9. Jul, 01:21
Wir erfahren in diesem Abschnitt, wie Buber das Wort “Selbst-Widerspruch“ gebraucht. Offenbar ist es das Gegenteil des Dialogs, der Zwiesprache in der Beziehung: also das Wort, das das Ich an sich selbst richtet. Und das kann keine Zwiesprache oder Zusprache sein, sondern nur gegen an gehen, also „wider“ das Ich.
Soweit, so klar, wohl. Interessant ist noch das Wort vom „eingeborenen Du,“ das sich am begegnenden (Du) auswirken kann. Ich glaube ersteres Du ist das Ich, vom Du aus betrachtet. Also: jedes Ich erst ein Ich am Du, jedes ich erst ein Ich, wenn es einem Du ein Du ist. Hier kommen wir also wieder an die Grenzen der Worte und er Begriffe. Wir haben ja schon oft gelesen, daß ein Ich (oder Du, oder Es) nicht unbedingt eines ist, nur weil wir es nicht anders bezeichnen. Ich denke, man könnte also sagen: „Das unentwickelte, potentielle Ich (im Text: Es) entfaltet sich am unnatürlichen, am unmöglichen Gegenstand, an sich selbst ...“ Damit wird klarer, daß dort der Raum fehlt, wo sich irgend etwas (etwa eine Beziehung ...) entfalten könnte.
sehen - 9. Jul, 01:20
In Abschnitt 9 stand, so lese ich es, dass es keine zwei Formen des „ich“ gibt, nur eine, die sich aber im Eigenwesen zusehends „entwirklicht." In Abschnitt 10 lasen wir dann von drei Beispielen herausragend personhafter Ichs. In Abschnitt 11 konnte ich das Wort Eigenwesen zwar nicht finden (wohl aber Eigenmenschen) – Napoleon soll wohl aber ein Beispiel sein für jemand der ganz Eigenwesen genannt werden könnte: jemand, der kein DU kannte. Im Gegensatz zum „modernen Eigenmenschen“ habe Napoleon aber ein aus dem Ich-Du stammendes Ich nicht einmal vorgetäuscht (hier wohl ein Hinweis auf den Narzissmus). Buber fragt nach Berechtigung und Sendung hinsichtlich Napoleons So-Seins, beantwortet diese Fragen aber nicht abschließend. Ich verstehe ihn so, dass er Napoleon im luftleeren Raum hängen läßt. Über „ihn“ läßt sich nicht viel sagen, denn es sei nicht einmal klar, ob er (Napoleon) selbst seine Sendung verstanden habe. Buber attestiert ihm wohl Schickung (was ist der Unterschied zur Sendung ?) und Vollzug, nicht aber Machtbrunst und Machtgenuß. Dass Napoleons Ich-Sagen „rechtmäßig“ gewesen sein könnte, lehnt Buber offenbar ab – wenn auch nicht explizit. Ich denke, das führt zurück zu Kapitel 9, wonach es insofern nicht zwei (oder mehr) verschiedene Menschentypen gäbe, nur eben solche, die sehr stark in der Beziehung lebten und andere, bei denen das quasi völlig verschüttet sei. Napoleon also ein Beispiel für letztere darf also wie jeder andere auch rechtmäßigerweise „ich“ sagen – er hat nur keine Ahnung, wovon er spricht. Und ebensowenig die, die ihm (oder ähnlich verblendeten Menschen) folgen.
sehen - 7. Jul, 07:19
Es ist in den ersten Zeilen klar, Buber identifiziert sich mit Sokrates. Ich werde gleich kritisch, da er offenbar Sokrates idealisiert, der zwar selbst erheblich logische Fehler machte, dessen Form, wie ich beim vorangegangenen Abschnitt meinte, Buber aber nicht erreicht.
Der Punkt ist aber ein ganz anderer, fange ich an, beim Weiterlesen zu verstehen. Buber zielt nicht auf die Richtigkeit, sondern auf das Engagement von Sokrates in der Wirklichkeit. Denn so geht es mit Goethe und als Gipfel des Engagements mit Jesus weiter: Goethe kann man pathetisch finden und sich distanzieren. Goethe kann man aber wohl nicht abstreiten, dass er wohl wie wenige engagiert gewesen ist. Und Jesus dann eben noch mehr: engagiert im Sinne von „im höchsten Maße verbunden,“ eins in dieser unsichtbaren Hülle, die Ich und Du zu einem Dritten verbindet – der Beziehung der gemeinsamen Wirklichkeit.
Und der Hinweis auf die doppelte Verbundenheit Jesu – mit dem Vater und mit seinen Brüdern und Schwestern. Für Buber ein Beispiel für das „heilige Grundwort.“ Und: die „Größe“ (eher „Wirklichkeit“) des Ich bemißt sich nach seiner Verbundenheit. Diese „Vorbilder“ sind also Giganten, nicht weil sie sehr klug waren oder großes geleistet haben, sondern weil sie so verbunden waren, so sehr in der Wirklichkeit engagiert waren. Ha – ich bin mal wieder begeistert !
sehen - 5. Jul, 13:15
Buber versucht der Form nach etwas zu beweisen und benutzt – der Form nach – auch so etwas wie die sokratische Methode. In Wirklichkeit verweist er, wenn ich den Text nicht zu oberflächlich lese, einerseits auf bereits gesagtes zurück, andererseits appelliert er an die Erfahrung und das tiefere Verständnis seines Leser-Gegenübers. Das spricht er auch an: „prüfen wir es, prüfen wir uns ...“ – der Schwerpunkt liegt ganz überwiegend beim „prüfen wir uns“ – und das außerhalb der Methoden des Strengbeweises ...
Dann aber spricht er wieder spannende Beobachtungen oder Thesen aus: Es gibt nicht zweierlei Menschen, aber wohl doch zweierlei Ichs. Beide Ichs, das des Grundworts Ich-Du und das des Ich-Es stecken in allen von uns, beide sind also typischerweise auch gleichzeitig „wirklich“ – aber sie sind auch so etwas wie eine je unterschiedliche Dimension (das ist nicht Bubers Wort). Person und Eigenwesen als Beschreibung dieser unterschiedlichen Fakultäten. Das Ich der Person ist wichtig im bzw. für den Gegenüber, selbst ist es „bedeutungslos.“ Die „Person“ (also die Maske) spielt zwar buchstäbliche eine Rolle. Ihr „Ich“ ist aber „nur“ notwendig für die Beziehung mit der anderen Person/Rolle an die es sich wendet: das was zwischen den Beiden entsteht ist wichtig, die Beziehung – nicht, was hinter ihnen steckt (das ich, jeweils – obgleich zweifellos vorhanden):
Das Ich zum Ich-Es ist hingegen „bedeutungsschwer“ – letztlich hat es aber keinen Gegenüber, weil alles zu diesem ich gehört, Adjektiv darstellt, allenfalls in „meins“ und „nicht meins“ untergliedert ist.
„Wo Selbstzueignung ist, ist keine Wirklichkeit“ – das ist für mich der spannendste Satz des Abschnitts. Selbstzueignung als das Typische der Ich-Es-Situation. Selbstzueignung „verhindert“ vielleicht nicht, dass etwas entsteht. Aber wo sie ist, ist einfach nichts lebendiges. Sie ist so wenig lebendig, dass sie nicht einmal etwas verhindern könnte – quasi ein Vakuum, eben ein Vakuum der „Wirklichkeit.“
Und dann spezifiziert Buber die „zwei Ichs“ im vorletzten Abschnitt sehr passend: wir „haben“ nicht zwei Ichs – wir leben in einem zwiefältigen Ich. Einige von uns leben so sehr in der einen, einige so sehr in der anderen Möglichkeit, dass Buber sie Person oder Eigenwesen bezeichnen würde – aber nicht als zweierlei Menschen(-Typen). In den „Eigenwesen“ wartet dennoch auch das Personische darauf, aufgerufen zu werden. Und ebenfalls sehr spannend: zwischen Eigenwesen-Typen und Personen-Typen trage sich die wahre Geschichte aus.“ Geschichte ist offenkundig nicht „Beziehung“ – aber doch ein sehr wesentliches Ringen.
sehen - 4. Jul, 08:43
Götter und Dämonen. Buber macht diese Unterscheidung immer wieder ein Stück weit mit. Ich weiss nicht, ob der Dualismus im Zentrum seiner Weltsicht steht, gut und Böse stehen sich gegenüber, aber nicht wie ich und du oder ich und es, sondern wie innen und außen. Entweder, Du hast es (gerade), oder nicht, Du bist in der Gnade oder nicht, Du bist in der Beziehung oder nicht.
Also, die Dämonen sind die, die es nicht haben. Von ihnen kommt die Frage – wahrscheinlich schon die falsche. Auf jeden Fall aber falsch beantwortet. Götter hätten die Frage sicher nicht gestellt, aber sie haben sie „richtig“ beantwortet: in der Beziehung. Der Urgeist ist auf der Seite der Götter. Die Götter sind nicht irgendwer. Bei ihnen ist der Urgeist. Sie haben ihn nicht, auch wenn er sich ihnen gab.
Buber hat diese kleine Geschichte nicht zur Auflockerung aufgenommen, sondern weil sie vollständig seine Auffassung ausdrückt. Sie ist wahrscheinlich ganz gut auch ohne Bubers Texte zu verstehen. Aber Bubers Texte sind besser zu verstehen mit dieser Geschichte. Und, wie immer, steckt natürlich noch viel mehr in der Geschichte. Ich bin gespannt. !
sehen - 3. Jul, 10:24
ja, ab dem Wochenende komm ich wohl wieder regelmäßig zum buber lesen und ich hoffe, manch eine macht mit.
und gerade kam mir schon mal eine idee zur gestaltung unseres wochenende im februar:
vor vier jahren hatte ich mich mal mit pawel florenski befaßt, von dem einige sehr schöne bücher bei der editionKONTEXT erschienen sind. Den hat wahrscheinlich noch niemand mit buber verglichen. ich schlage vor, es mal zu versuchen. auch florenski hat seine freien gedanken nur aus dem leben und aus einem sehr frommen heraus entwickelt, ist also wie buber kein philosoph iSv mathematischer theoretiker (weiss selbst nicht, was das ist). florenski hatte es sich zur lebensaufgabe gemacht, alles was zusammengehört (alles) zusammen zu bringen - also vor allem als "zusammen"wahrzunehmen. ich hab das verständnis, dass er damit sehr nah bei buber ist - was meint Ihr ?
sehen - 29. Jun, 20:37
nachdem meine Liebste nun auch wieder an ihren PC kann und ich mein kleines Buchprojekt in den nächsten Wochen abschließen kann, das Buber Seminar wohl im nächsten Frühjahr stattfinden kann, tja, da werd ich wohl auch bald wieder zum Buber zurückkehren. Ich kann nur noch nicht versprechen, dass das im Juni mit Regelmäßigkeit geschehen wird - eher dann im Juli.
Und statt einem Pausenbild etwas zu meiner derzeitigen Bettlektüre: Frans de Waal "Good natured" - großartig, super spannend die Einführung in Moral und Ethik bei den Menschenaffen. Ich bin drauf gestoßen, weil ich vor einem guten Jahr oder einen Artikel über eine Forschungsarbeit des gleichen Autors las. Frieden schaffen bei den Affen - so hab ich dann eine Zusammenfassung überschrieben ;-)
Also - in disem Sinne - nicht zuviel Theorie und Gegenüberstellung ...
sehen - 3. Jun, 04:02
Zu Kapitel II.8 fällt mir nichts ein - nette Geschichte über Beziehung.
Aber zu Kapitel II.9 und II.10. habe ich im Wörterbuch nachgeschlagen, vielleicht gibt es ja noch mehr teilgebildete Du's auf dieser Seite, die Erklärung brauchen:
Alp = unterirdischer Naturgeist, gespenstisches Wesen
Schibboleth = Erkennungszeichen, Losungswort
Daimonion = warnende Stimme der Gottheit
Kapitel II.9.
Ob ich nun sage: "Ich sehe dich" oder
"Ich sehe den Baum",
vielleicht nicht gleich wirklich ist in beidem das Sehen,
aber gleich wirklich ist in beidem das Ich.
Das Ich des Grundworts Ich-Es wird sich bewusst als Subjekt -
Das Ich des Grudworts Ich-Du wird sich bewusst als Subjektivität.
Es gibt nicht zweierlei Menschen; aber es gibt die zwei Pole des Menschentums.
Durch die Berührung jedes Du
rührt ein Hauch des ewigen Lebens an.
Da kommt mir ein Gedicht von Karl von Frisch (1927) in den Sinn:
Begegnungen
Menschen gibt es viele.
Sie wandeln ihren Weg,
Jeder nach seinem Ziele.
Jeder auf seine Steg.
Wenn sie einander streifen,
Streifen sie vorbei;
Selten, dass sie begreifen,
Wes Art der andere sei.
Seltener noch, dass leise
Beim Streifen die Seele klingt
Und dass des anderen Weise
Froh in uns weiter klingt.
Und woran ich in diesem Kapitel noch rumbeisse ist:
"Alle Wirklichkeit ist ein Wirken,
an dem ich teilnehme,
ohne es mir eignen zu können."
bahnfahrerin - 23. Mär, 22:21