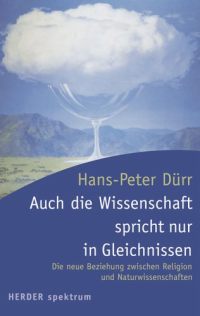Ich und Du - das Buch
Die drei „Todsünden“ – die eigentlich nur eine sind, nämlich Verblendung, und als solche aber wirklich als Versündigung, nämlich gegen den Geist verstanden werden können. Wer dem Geist abschwört, schwört dem Leben ab – gefährlich auch für alle Umstehenden !
Wenn man Buber im historischen Kontext sieht, sehen wir hier die von so vielen empfundene, gefährliche Leere der Zeit, die zum ersten großen europäischen Stammeskrieg geführt hat – und dann zum nächsten ...
„... keine Aufrührung der Peripherie kann die Beziehung zur lebendigen Mitte ersetzen.“ Das heißt wohl, lieber einen Monarchen, der dem Geist botmäßig ist, als eine Revolution von Dilettanten. Der Staats- oder Wirtschaftsmann, der dem Geist botmäßig ist, schwärmt nicht, sondern dient der Wahrheit. Die Staats- oder Wirtschaftsfrau – dürfen wir wohl heute ergänzen – weiss, dass sie das DU nicht rein verwirklichen kann, aber sie weiss, wo sie ist und was sie tut, sie hat ein Gespür – für den Geist, das menschliche Maß oder überhaupt, dass ihr gegenüber Menschen und andere Wesen der Schöpfung sind, denen sie sich so gegenüber verhalten kann, dass die Schöpfung weitergeht.
„Erlösung“ – das steht hier ganz klar nicht für die Beendigung des irdischen Lebens, sondern eher für eine Herauslösung aus der Geistlosigkeit, nach dem Bild des dem Lehm Geist Einhauchens. Wo wir das mit unserer Umgebung schaffen, sind wir an der Schöpfung beteiligt, finden wir auch selbst Erlösung – und stehen ganz nebenbei dem Du gegenüber.
sehen - 8. Mär, 09:29
Hier wurde ja verschiedentlich der Verdacht geäußert, Buber sei schon Es-feindlich. Er hat ja auch an anderer Stelle erklärt, warum er sich in der Verantwortung sieht, das Du zu fördern. In diesem Abschnitt schreibt er also, warum der Mensch sich um seine Haltung zum Es kümmern soll: Das Es habe die Neigung, alles zu überwuchern – Buber also, der die krebsartigen Eigenschaften des Es entdeckt hat und vor ihnen warnt, aber auch ein Gegenmittel bereit hält. Und: die dauernde, ausschließliche Ich-Es-Bezogenheit führt zu Unerlöstheit – im besten Fall sogar zu deren Wahrnehmung ...
sehen - 7. Mär, 09:19
Wieder geht Buber von einer Behauptung (Grundthese, Warnung ?) über das Verhältnis der Ich-Es- zur Ich-Du-Situation aus. Zuvor hatte er schon eine zwangsläufige ständige Verstärkung und Ausweitung der Ich-Es-Welt konstatiert. Nun meint er, die Ausbildung, der auf die Ich-Es-Situation bezogenen Funktion, erfolge (meist) durch eine Minderung der Beziehungskraft. Diese Ausbildung geht also nicht mit einer Minderung der Beziehungskraft einher, sondern sie hat diese Minderung zur Grundlage, wächst aus ihr. Die Minderung der Beziehungskaft sei Werkzeug zur Ausbildung der erfahrenden und gebrauchenden Funktion. Hmm ? Jedenfalls sehe ich den Rest des Abschnitt nicht als Erklärung dieser Behauptung – auch wenn wir selbst da intuitiv einen wie auch immer genau gearteten Zusammenhang sehen mögen. Spannend wäre halt, wie genau der beschaffen ist...
Dann weiter: Der Geist als Genußmittel – das kann wohl nicht der gleiche Geist sein, von dem Buber in Abschnitt 2 spricht.
Der Mensch- unter dem Grundwort der Trennung (eine neue Beschreibung der Ich-Es-Situation, dann die Ich-Du-Situation also als Grundwort der Beziehung) stehend – trennt sein Leben mit den Mitmenschen in Ich-bezogene Anteile (die Welt des Gefühls) und Es-bezogene (die Einrichtungen). Entscheidend hier also (wie schon in Teil 1) die Zuordnung der Gefühle nicht zur Beziehung (dem Zwischen) sondern zum Ich. Die Welt des Ichs, die Welt der Gefühle sodann als „Schaukelstuhl.“ 80 Jahre später mag man das schon als nachgerade positiv, weil gefühlsoffen, ansehen. Tatsächlich geht es um eine Beschreibung des Narzissmus – der aussichtslosen Ich-Bezogenheit. Und dann erwähnt er die Gefühle in Politik und Verbänden – erhellendes über die desaströse Rolle von beziehungsloser, narzisstischer Ich-Bezogenheit im öffentlichen Raum.
Den Menschen kennt weder das ich-bezogene, noch das es-bezogene, denn beide Situationen kennen weder das Zwischen, noch das Du. Der Sinn für Gemeinsamkeit entsteht gerade erst aus dem Sinn für das dazwischen (was eben nicht so sehr trennt, sondern verbindet) und das Du (nicht gegenüber, sondern umfassend). Ich und Es brauchen dann übrigens nichts „trennendes,“ denn sie haben nichts verbindendes. Ich und Es haben in der Ich-Es-Situation je eine Außenwand, je ihre eigene Definition, Grenze. Da muss sich also nichts trennendes dazwischen schieben: so etwas trennendes wäre in Wirklichkeit etwas verbindendes, nämlich etwas, dem Ich und Du gemeinsam anliegen.
Gefühle ohne Du sind unwirklich – auf das Ich bezogen können sie nicht wirken. Die Verzweiflung über die Unwirklichkeit der Gefühl (oder jedes andere folgende Gefühl) läßt einen unproduktiven Kreislauf entstehen.
Einrichtungen (Es-Welt) Gefühle (Ich-Welt) aufzupfropfen führt nur zu weiterer Verwirrung, nicht zu einer Verbesserung des Zustands, denn so entsteht weder (wohlverstandenes) öffentliches Leben, noch persönliches Leben. Beides entsteht nur durch Beziehung nach der Art der des Rades, das durch Speichen mit der Nabe verbunden ist, durch die lebendige Mitte. „...Gemeinde entsteht nicht dadurch, dass Leute Gefühle für einander haben (wiewohl freilich auch nicht ohne das), sondern durch diese zwei Dinge: daß sie alle zu einer lebendigen Mitte in lebendig gegenseitiger Beziehung stehen und daß sie untereinander in lebendig gegenseitiger Beziehung stehen. Das zweite entspringt aus dem ersten, ist aber noch nicht mit ihm allein gegeben.... der Baumeister ist die lebendige wirkende Mitte.“ Das metaphysische Faktum der Liebe ist, dass sich zwei Menschen das Du offenbaren. Von dort aus läßt sich auch die Ehe erneuern, nicht etwa von der Erotik, die sich auf ich-bezogene Gefühle beschränkt.
Einrichtungen und Gefühle sind also für „wahres“ öffentliches und privates Leben notwendig, geschaffen wird es aber nur von dem in der Gegenwart empfangenen zentralen Du.
sehen - 4. Mär, 09:09
Der Geist in seiner menschlichen Kundgebung ist also nicht nur Antwort, sondern wie im Abschnitt zuvor gesehen, etwas, worin der Mensch leben kann.
Der Geist ist nach Buber unabhängig von seiner Ausdrucksform, da letztere Produkt einer doppelten Brechung ist: Geist als Antwort muss sich erst im Menschen formen und dann muss diese Antwort auch noch einen äußeren Ausdruck finden.
Buber meint der Mensch lebt (steht) in der Sprache. Das ist wohl, ebenso wie oben beim Geist, der Hinweis auf die allumfassende, grenzenlose, du-bezogene Eigenschaft der Sprache, wie des Geistes: nicht wie das Blut in Dir, sondern wie die Luft um uns: ein sehr vereinigender Gedanke. Immerhin ist die Luft (wie der Geist ?!) an nationale Grenzen nicht gebunden.
„Der Mensch lebt im Geist, wenn er seinem Du zu antworten vermag ... wenn er in die Beziehung mit seinem ganzen Wesen eintritt.“ Daher also diese doppelte Eigenschaft des Geistes: der Geist ist die Antwort, die Beziehung und daher „alles“ oder allumfassend.
Je deutlicher, klarer, kräftiger aber diese Antwortseite des „Geistes,“ der Ich-Du-Beziehung sind, desto eher wird daraus auch ein sprachlicher Ausdruck – und schon wieder sind wir beim Es. Das „reine“ oder wie Buber besser sagt „freie“ Du steht da, wo der Geist sich nicht kundtut, sondern ist. Das mache das besondere Menschliche aus: dass sich für den Menschen so Erkenntnis, Werk, Bild und Vorbild entwickeln kann – „in der Mitte des Lebendigen“ – und aus ihr heraus... Das sei aber nur die eine Seite des typisch Menschlichen, dem Buber aber schon eine tragische Seite gibt. Die andere Seite sei der inhärente Aufruf, oder die immer bestehende Möglichkeit, vom Es zum Du zurückzukehren: vom Gegenständlichen zur Gegenwart.
Die Basis von Erkenntnis ist im für Buber wohlverstandenen Sinn, das Du-hafte Schauen in einem Es-orientierten Prozess der Erkenntnisvermehrung. Wer danach den „Gegenstand“ aus der begrifflichen Erkenntnis wieder herausnehmen kann, hat die Möglichkeit wieder ich das Ich-Du, also in die Gegenwart, einzutreten.
Und zum Schluss führt Buber noch das „reine Wirken, die Handlung ohne Willkür“ als höchste Ausdrucksform des Geistes ein: Die Antwort mit dem Leben. Das sein Leben sprechen lassen. Dieses Leben sei Lehre. Nicht Lehre darüber, was ist und was sein soll, sondern wie im Geist, im Angesicht des Du gelebt wird. Das führt also zurück zur Beziehungskraft, die laut Abschnitt 1 heute (bzw. vor 80 Jahren) so sehr gemindert sei.
Aha. Buber sagt, er habe keine Lehre. Vielleicht sollten wir uns doch sein Leben ansehen, soviel wir hinter den Schriften davon als Antwort auf den Geist finden können.
Dieses Leben – das erlebte Leben – ist dann möglicherweise Schlüssel zum Du und kann auch selbst zum Du werden. Wer „Bescheid weiss,“ die Welt erobert hat, alles im Buch gelesen hat, verfehlt so das Du. Verehrung und Anbetung ist etwas völlig anderes, als sich anrühren zu lassen – umfassend anrühren zu lassen.
sehen - 3. Mär, 08:46
Dieser Abschnitt endet mit einer Behauptung, in der Du, mimi23, wohl schon die deutliche Bevorzugung des Ich-Du gegenüber dem Ich-Es siehst: „Denn die Ausbildung der erfahrenden und gebrauchenden Fähigkeiten erfolgt zumeist durch Minderung der Beziehungskraft des Menschen – der Kraft, vermöge deren allein der Mensch im Geist leben kann.“
Das bleibt zunächst reine Behauptung. Wir haben zwar vielleicht das Gefühl, dass das stimmen könnte. Vielleicht wird Buber das auch in den weiteren Abschnitten von Teil II erläutern. Nach dem in Abschnitt I gelesenen kann ich das bisher nur so verstehen, dass die in der Welt der Gegenstände erworbenen Fähigkeiten dazu führen, dass wir uns in dieser Welt immer besser einrichten können und immer weniger Neigung verspüren, uns auf die Ich-Du-Möglichkeit einzulassen. So wie Buber im letzten Abschnitt von Teil I schreibt: „In bloßer Gegenwart läßt sich nicht leben ... Aber in bloßer Vergangenheit läßt sich leben, ja nur in ihr läßt sich ein Leben einrichten.“ Dieses „Einrichten“ eine typische Ausprägung der Ich-Es-Situation.
Übrigens ein paralleles Gefühl drückt wohl Fromm in „Haben oder Sein“ aus.
Wenn wir aber kritisch an Bubers Behauptung weiterdenken, werden wir prüfen müssen, was er mit „Beziehungskraft“ (der Kraft, vermöge deren allein ...) und was er mit „im Geist leben“ meint.
Im übrigen ist sich Buber bewußt gewesen, dass seine Untzerscheidung zwischen Du und Es (Sein und Haben) vielleicht etwas schwarz weiss ist. Er soll das aber mit der Erklärung gerechtfertigt haben, in einer Zeit in der das haben bestimmend sei, habe er die Aufgabe, den Primat des dialogischen Seins verstärkt und damit eben einseitig herauszustellen.
sehen - 2. Mär, 08:02
Warum überhaupt die Du-Welt würdigen und ganz klar erkennbar ist, dass Buber die Du-Welt sozusagen für unterbewertet hält.
Der erster Teil schließt in diesem Absatz keinesfalls mit einem flammenden Plädoyer für das Du – ich würde das auch nicht erwarten. Statt dessen weist Buber ganz nüchtern darauf hin, warum die Menschen eine zum Es haben – und alle andere Schöpfung, die eine solche Tendenz entwickeln kann, wahrscheinlich auch. Die Ich-Es-Beziehung ist existentiell nötig. In der Ich-Du-Beziehung (Buber sagt: „in der Gegenwart“) läßt sich nicht leben. Er geht sogar soweit zu sagen, nur in der Vergangenheit ließe sich ein Leben einrichten.
Allerdings ist schon zu hören, dass Buber Zweifel daran trägt, ob Leben dazu da sein, eingerichtet zu werden. Ganz klar ist er darin, dass wer mit dem Es allein lebt, sei nicht „der“ Mensch – was ich so verstehe, dass er wesentliche Eigenschaften des Menschlichen verfehle, oder zumindest das Potential nicht erreiche.
Ein sehr schöner „Spruch des Tages“ sicher:
„Man braucht nur jeden Augenblick mit Erfahren und Gebrauchen zu füllen, und er brennt nicht mehr.“
Ich kann besser mit den Dingen leben, die mehr Frage, als Zufriedenheit hinterlassen !
Damit ist also Teil I vorbei. Es folgt Teil II und III sowie das Nachwort vom Oktober 1957. Mag jemand anders vielleicht den nächsten Teil übernehmen ?
sehen - 28. Feb, 08:50
Buber beschreibt wieder das Unbeschreibbare. Es ist nicht eine Zusammenfassung, sondern wir begegnen wieder neuen Aspekten der Wahrnehmung, der Gegenwart, des Du. Oder Bildern. Mit ihren inhärenten Widersprüchen. Ich will hier jetzt gar nicht näher darauf eingehen, obgleich oder gerade weil es mir relativ einfach zu sein scheint, über diesen Abschnitt zu reden - unter der Voraussetzung der vorangegangenen wohl - und eigenem Erleben.
Bei aller Kritik und Interpretation müssen wir natürlich immer sehen, dass es hier definitionsgemäß um das Unbeschreibbare geht. Gleichzeitig soll es nicht „Esoterisch“ sein – wobei die Behauptung allein, dass es sich um die Welt handele, wie sie jedem Menschen in seinem einmal und immer wieder begegne, also um „die Wahrheit“ natürlich nicht das Verbot von Hinterfragen – sowohl der Wahrnehmung als auch der Worte enthält. Spannender als dies ist aber die Frage an uns: was kannst Du sagen – oder: wie würdest Du das ausdrücken. Die Sprachdichte von Buber ist sicher nur eine Möglichkeit unter vielen und es gibt viele andere, die sich mit gleichen Wahrnehmungen befaßt haben. Offenbarung scheint mir übrigens ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang.
Und ich glaube nicht, dass die Welt des DU wichtiger ist, ich verstehe es nicht so, dass sie für Buber „wichtiger“ sei. Sie ist aber. Und sie ist nach Buber zwingende Voraussetzung der Begegnung mit Er/Sie/Es und vorher noch für die Herausbildung des Ich. Und wir können viel Kraft aus der Ich-Du-Situation schöpfen.
sehen - 25. Feb, 08:58
Ich glaube, an diesem 12 Zeilen kurzen Abschnitt kann man ganz gut demonstrieren, was Buber lesen heißt, oder heißen kann.
Nach dem ersten Mal durchlesen, würde ich sagen, ist der Abschnitt auf Anhieb unverständlich. Also: Buber kann und will nicht auf Anhieb verständlich sein. Zum einen behauptet er, von dem zu sprechen, das teils kaum in Worte zu fassen ist. Zum anderen will er in der Ich-Du-Beziehungssituation sprechen – d.h. es kann sein, dass (er oder) der Leser die Ebene gerade verfehlt und diese Kommunikation scheitert, aber auch nicht auf einer anderen Ebene stattfindet.
Ausweg 1, den ich sehe, also: mit möglichst großer Ruhe und Entspanntheit Wort für Wort aufnehmen, sich an all das erinnern, was Buber bereits zuvor gesagt hat und die Resonanz, die es bei einem gefunden hat, sehen, was Buber „meint.“ Das ist kein „wissenschaftliches“ Verfahren, d.h. es ist mit dem Risiko behaftet, dass ich einerseits vielleicht genau den „Sinn“ finde, den Buber meinte, oder andererseits weit daneben liege – und weder erkennen noch erklären kann, was von beiden es ist und wie ich da hingekommen bin.
Ausweg 2, der auch möglich ist, ist die Bemühung mit klassischen Methoden der Textarbeit, den Text zu entschlüsseln. Vielleicht läßt sich auch Weg 1 und 2 ein Stück weit verbinden, wie auch Archäologen auch auf Intuition – will sagen: Wahrnehmung und nicht nur Analyse dessen, was der Kopf bekanntes wiederentdeckt - angewiesen sind.
Buber beginnt diesen Abschnitt also mit einer Frage, woher die Schwermut unseres Loses kommt. Woher diese Frage kommt, ergibt sich nicht, auch nicht aus den vorangegangenen Abschnitten, denn da ist zwar von Entwicklung die Rede, als dem „woher,“ aber nicht vom Los oder von Schwermut. Die Frage ist also angefüllt mit Unterstellungen, ruft also nach Gegenfragen, bzw. der Reaktion: „oh, Du empfindest also ein „Los“ und siehst dies mit Schwermut verbunden ...“
Statt sich aber auf einen derartigen Dialog einzulassen, weist Buber selbst die Frage gleich teilweise zurück und bestätigt nur den Entwicklungsaspekt – wie er sich eben auch aus dem vorangegangenen Abschnitt ergibt. Er bestätigt das aber nicht einmal wirklich, da er „wohl“ und „insofern“ sagt. „… insofern das bewußte Leben des Menschen ein urgeschichtlich gewordenes ist:“ das ist eigentlich gar keine Antwort, denn wir wissen nichts über das bewußte Leben des Menschen und ob bzw. gar inwiefern es ein urgeschichtlich gewordenes ist. Im darauf folgenden Satz behauptet er (geschickt mit dem Wort „nur“ verstärkt), die Individualentwicklung sei nur ein Abbild des Seins ins Gesamt („welthaft“) in Gestalt eines menschlichen Werdens. Interessanter Gedanke: ein (wohl scheinbares) Werden emuliert ein Sein. Nächstes Sprung – zum Geist und der Zeit. In der Tat ist der Zeitfaktor bzw. dessen Illusion in dem vorangegangenen angelegt. Der Satz könnte also additiv beginnen: „Auch der Geist...“ – das wäre allerdings falsch im Buber’schen Sinne, da es sich beim Geist eben nicht um etwas abgetrenntes handelt. Also wäre der letzte Satz dieses Absatzes auch etwa so zu lesen: „Alles und seine imaginären Teile erscheint in dem, was man für Zeit hält, als Zusammengesetztes und Entstandenes, als Ausgeburt oder Nachgeburt der Natur – richtiger ist die Natur aber eingefaßt – aber ohne strikte Abgrenzung von dem Ganzen und ohne dass der zeitliche Aspekte dabei ein Rolle spielt.“
Und dann geht Buber weiter und behauptet im zweiten Absatz dieses Abschnitts, dass der Gegensatz der Ich-Du zur Ich-Er/Sie/Es-Situation (den beiden Grundworten …) schon immer war (zeitlos ist bzw. „der Schöpfung inhäriert“ – inhärent: wörtlich „einhängend“ also soviel wie zugehörig), auch wenn er in unterschiedlichen Zeiten, Kulturen und Sprachen unter vielen verschiedenen Namen auftreten mag.
Also, dieser Abschnitt läßt sich mathematisch, grammatisch und kontextuell sicher noch weiter und besser auslegen. Nach meinem Eindruck würde ich sagen: ja, er hat seinen Zusammenhang, ist keinesfalls sinnlos oder unsinnig, wie es beim ersten Lesen erscheinen mag. Seine tiefe Bedeutung, die den Leser weiter tragen soll, erschließt sich mir nicht – dafür reibe ich mich hier zu sehr an Behauptungen. Die können erst wieder versöhnt werden, wenn ich weiterlese und merke, wie Buber es „eigentlich“ und kurzgefaßt meint – das ahne ich natürlich auch schon vor dem Hintergrund des bereits gelesenen...
Vielleich läßt sich ein Hauch von Dreieckbeziehung aufbauen, wenn das Du der Du-Baumbeziehung so be-geist-ernd dem Du der Ich-Du-Beziehung erzählt, dass eine Brücke entstehen kann, so dass eine Beziehung entsteht zwischen dem anderen Du und dem Baum.....aber das geht nur, wenn man davon ausgeht, dass sich die Aktualität, die Gegenwart der Beziehung nicht in einer limitierenden Zeit-Raum-Wirklichkeit abspielt, sondern alles ausfüllend ist. Aber vielleicht spricht genau das dagegen. Und wo ist dann das ewige Du?
Interessant finde ich, dass die Voraussetzung für die Ich-Er/Sie/Es- Beziehung die Werdung des Ichs duch Ich-Du-Beziehung ist. Buber spricht später sehr verdammend von denjenigen, die in Ich-Es-Beziehungen nur den Gebrauchswert sehen. Das sind für ihn diejenigen, die in keine Ich-Du-Beziehungen eintreten (können). Es gibt also viele Arten der Ich-Es-Beziehung, und sie unterscheiden sich in ihrer Qualität enorm auch in ihrer Wechselwirkung auf die Ich-Du- Beziehung.
sehen - 17. Feb, 13:27
Buber bezieht sich auf wiederum auf entwicklungsgeschichtliche Erkenntnisse, wonach sowohl bei „primitiven „Völkern,“ als auch eben in der Individualentwicklung zunächst nur das „Grundwort“ Ich-Du, als die Ich-Du-Beziehung oder –Situation existiert. Bemerkenswert ist, dass aus Bubers Sicht die ganz klar ohne eine Trennung zwischen Ich und Du auskommt – es gibt nämlich gar kein wahrgenommenes Ich. Es gäbe ich dieser Situation („Beziehungsereignis“) „nur die zwei Partner, den Menschen und sein Gegenüber, in ihrer vollen Aktualität...“ Ein bißchen schwierig zu erklären ist dabei, dass es in dieser Situation (es handelt sich nicht so sehr um einen Zeitpunkt ...) kein wahrgenommenes, separates oder separierbares Ich gibt – denn das ist erstmals noch gar nicht „hervorgetreten.“ Andererseits, das sagt Buber an dieser Stelle nicht ausdrücklich, scheint mir aber für das Verständnis sehr wichtig: in der Ich-Du-Situation gibt es eben generell kein separates Du: die Ich-Du-Situation ist alles, füllt alles aus ...
Dann erst (entwicklungs- bzw. individualgeschichtlich) lernt der Leib sich selber kennen und unterscheiden – daraus wird Ich und das erste Es. „...das hervorgetretene Ich erklärt sich als den Träger von Empfindungen, die Umwelt als deren Gegenstand.“ Damit entsteht das Ich und das Er/Sie/Es etwa gleichzeitig – allerdings ist das erste Er/Sie/Es ein Teil des Körpers oder der Körper selbst ...
Dann kommt Buber zu dem Satz: „Ich sehe den Baum.“ Er weist daraufhin, dass dieser Satz eine Bezeichnung der Ich-Du Situation zum Baum erzählen kann, ebenso aber auch eine Bezeichnung der Ich-Er/Sie/Es-Situation zum Baum. Das würde ich dahingehend ergänzen, dass von der Ich-Du-Sutuation zum Baum wohl kaum berichtet werden kann, ohne sie verlassen zu haben und daher letztlich gar nicht oder allenfalls mehr oder weniger unvollständig und unverständlich – vielleicht ist aber ein Erzählen von der Ich-Du-Situation zum Baum „Ich sehe den Baum“ doch möglich, nämlich innerhalb einer weiteren Ich-Du-Situation zu einem anderen Menschen. Es ist mir also vorstellbar, eine Ich-Du-Situation zu einem Menschen aufrechtzuerhalten und erzählend einen Baum vorsichtig miteinzubeziehen, ohne die Ich-Du-Situation zum einen wie dem anderen zu verlassen. Geht das ?
sehen - 16. Feb, 09:22