Teil III, Abschnitt 1 – wenn sich Linien schneiden sind sie nicht parallel
Der erste Absatz besteht aus einem einzigen Satz: „Die verlängerten Linien der Beziehungen schneiden sich im ewigen Du.“ Das lehrt mal wieder Buber Lesen, habe ich den Eindruck: ich habe für mich versucht, den Satz grafisch umzusetzen. Zum einen war ich aber nie gut in Mathematik, zum anderen will sich Buber wohl nicht auf diese Art verstanden wissen. Jedenfalls habe ich es aufgegeben.
Ich konnte immerhin erkennen, dass Buber von mehreren Beziehungen spricht. Die Schwierigkeit in der Umsetzung liegt für mich aber schon darin, dass jedes Ich auch ein Du ist (OK, am Anfang des Buches stand, das müsse nicht immer so sein, aber es ist wohl eher die Regel als die Ausnahme – immerhin sprechen wir von Beziehung). Zum anderen paßt das Linienbild natürlich nicht gut zu dem Sphärenbild.
Das ist für mich nun schon ein erster Erkenntnisgewinn über das, wovon Buber spricht und ich muss zugeben, ich habe jetzt doch schon mal eine Runde weitergelesen und bin bis Abschnitt 7 gelangt. In den folgenden Abschnitten, auf die ich mich schon sehr freue, wird das vertieft, habe ich den Eindruck: es ist das eine (Linie) und/oder das andere (Sphäre). Nur das eine wäre falsch, ebenso nur das andere, aber auch „und“ bzw. „oder“ allein trifft es nicht ...
Es geht also „quasi“ um einen Raum („Sphäre“), der auf einen Punkt konzentriert ist (DE), von ihm ausgeht und auf ihn zurückführt, der die Dimensionen übergreift und in unseren Dimensionen nicht zu fassen ist.
Dann finden wir hier einen interessanten Satz über das ewige DU: es zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht Es werden kann. Ich habe den Eindruck, das wird ein Stück weit in den nächsten Abschnitten modifiziert – also mal sehen.
Das Linienbild wird im zweiten Absatz weiter verständlich gemacht und da kommen wir wohl zu Kernbestandteilen von Bubers Menschen- und Gottesbild, die sich von der Idee des „von Gott in jedem Menschen“ wohl nicht im Ergebnis, aber ganz sicher auf den Ebenen davor deutlich unterscheiden.
Jedes Du ermöglicht einen Durchblick zum ewigen DU. Das heißt, es ist nicht Teil des ewigen Du. Das Wort Durchblick bedeutet natürlich einerseits „Verständnis,“ weist im Bild das Buber gebraucht aber viel stärker auf so etwas wie Röhre, Schacht, Kanal hin. Man könnte also einerseits sagen, da wo man mit Blick auf das dem Ich gegenüberstehenden Du nichts sieht (obgleich man da eigentlich ALLES sieht), dort also, sieht man dann wirklich alles (nämlich das Ewige DU). Angesprochen sind also wieder eine Reihe von Paradoxien: Erfülltheit und Unausgefülltheit, Körperlichkeit und Schlüssellochleere, ein Durchblickschlüsselloch, das aber keinen Schlossmechanismus hat, keine Drehen im Schloss ermöglicht, das Nichts im Alles, das den Blick auf Alles ermöglicht – und all das auch nicht ...
Dann das Wort vom eingeborenen Du. Nur syntaktisch erschließt sich mir, dass das nicht das ewige sein kann (sondern das jeweils gegenüberstehende). Es verwirklicht sich an einer Beziehung, vollendet sich an keiner. Spannend ist, dass sich das eingeborenen Du nicht in einer Beziehung verwirklicht (weder in der Sphäre noch vermöge der Linien). Hingegen vollendet sich das eingeborene Du in der unmittelbaren Beziehung zum ewigen Du. Es vollendet sich – nicht: „es wird vollendet vom ...“ Und hier doch: in der Beziehung.
Ich konnte immerhin erkennen, dass Buber von mehreren Beziehungen spricht. Die Schwierigkeit in der Umsetzung liegt für mich aber schon darin, dass jedes Ich auch ein Du ist (OK, am Anfang des Buches stand, das müsse nicht immer so sein, aber es ist wohl eher die Regel als die Ausnahme – immerhin sprechen wir von Beziehung). Zum anderen paßt das Linienbild natürlich nicht gut zu dem Sphärenbild.
Das ist für mich nun schon ein erster Erkenntnisgewinn über das, wovon Buber spricht und ich muss zugeben, ich habe jetzt doch schon mal eine Runde weitergelesen und bin bis Abschnitt 7 gelangt. In den folgenden Abschnitten, auf die ich mich schon sehr freue, wird das vertieft, habe ich den Eindruck: es ist das eine (Linie) und/oder das andere (Sphäre). Nur das eine wäre falsch, ebenso nur das andere, aber auch „und“ bzw. „oder“ allein trifft es nicht ...
Es geht also „quasi“ um einen Raum („Sphäre“), der auf einen Punkt konzentriert ist (DE), von ihm ausgeht und auf ihn zurückführt, der die Dimensionen übergreift und in unseren Dimensionen nicht zu fassen ist.
Dann finden wir hier einen interessanten Satz über das ewige DU: es zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht Es werden kann. Ich habe den Eindruck, das wird ein Stück weit in den nächsten Abschnitten modifiziert – also mal sehen.
Das Linienbild wird im zweiten Absatz weiter verständlich gemacht und da kommen wir wohl zu Kernbestandteilen von Bubers Menschen- und Gottesbild, die sich von der Idee des „von Gott in jedem Menschen“ wohl nicht im Ergebnis, aber ganz sicher auf den Ebenen davor deutlich unterscheiden.
Jedes Du ermöglicht einen Durchblick zum ewigen DU. Das heißt, es ist nicht Teil des ewigen Du. Das Wort Durchblick bedeutet natürlich einerseits „Verständnis,“ weist im Bild das Buber gebraucht aber viel stärker auf so etwas wie Röhre, Schacht, Kanal hin. Man könnte also einerseits sagen, da wo man mit Blick auf das dem Ich gegenüberstehenden Du nichts sieht (obgleich man da eigentlich ALLES sieht), dort also, sieht man dann wirklich alles (nämlich das Ewige DU). Angesprochen sind also wieder eine Reihe von Paradoxien: Erfülltheit und Unausgefülltheit, Körperlichkeit und Schlüssellochleere, ein Durchblickschlüsselloch, das aber keinen Schlossmechanismus hat, keine Drehen im Schloss ermöglicht, das Nichts im Alles, das den Blick auf Alles ermöglicht – und all das auch nicht ...
Dann das Wort vom eingeborenen Du. Nur syntaktisch erschließt sich mir, dass das nicht das ewige sein kann (sondern das jeweils gegenüberstehende). Es verwirklicht sich an einer Beziehung, vollendet sich an keiner. Spannend ist, dass sich das eingeborenen Du nicht in einer Beziehung verwirklicht (weder in der Sphäre noch vermöge der Linien). Hingegen vollendet sich das eingeborene Du in der unmittelbaren Beziehung zum ewigen Du. Es vollendet sich – nicht: „es wird vollendet vom ...“ Und hier doch: in der Beziehung.
sehen - 15. Jul, 09:18
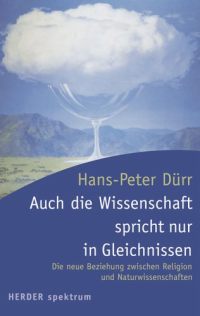
Trackback URL:
https://buber.twoday.net/stories/838197/modTrackback