Kapitel II Abschnitt 9 - Ich ist gleich ich, oder nicht ?
Buber versucht der Form nach etwas zu beweisen und benutzt – der Form nach – auch so etwas wie die sokratische Methode. In Wirklichkeit verweist er, wenn ich den Text nicht zu oberflächlich lese, einerseits auf bereits gesagtes zurück, andererseits appelliert er an die Erfahrung und das tiefere Verständnis seines Leser-Gegenübers. Das spricht er auch an: „prüfen wir es, prüfen wir uns ...“ – der Schwerpunkt liegt ganz überwiegend beim „prüfen wir uns“ – und das außerhalb der Methoden des Strengbeweises ...
Dann aber spricht er wieder spannende Beobachtungen oder Thesen aus: Es gibt nicht zweierlei Menschen, aber wohl doch zweierlei Ichs. Beide Ichs, das des Grundworts Ich-Du und das des Ich-Es stecken in allen von uns, beide sind also typischerweise auch gleichzeitig „wirklich“ – aber sie sind auch so etwas wie eine je unterschiedliche Dimension (das ist nicht Bubers Wort). Person und Eigenwesen als Beschreibung dieser unterschiedlichen Fakultäten. Das Ich der Person ist wichtig im bzw. für den Gegenüber, selbst ist es „bedeutungslos.“ Die „Person“ (also die Maske) spielt zwar buchstäbliche eine Rolle. Ihr „Ich“ ist aber „nur“ notwendig für die Beziehung mit der anderen Person/Rolle an die es sich wendet: das was zwischen den Beiden entsteht ist wichtig, die Beziehung – nicht, was hinter ihnen steckt (das ich, jeweils – obgleich zweifellos vorhanden):
Das Ich zum Ich-Es ist hingegen „bedeutungsschwer“ – letztlich hat es aber keinen Gegenüber, weil alles zu diesem ich gehört, Adjektiv darstellt, allenfalls in „meins“ und „nicht meins“ untergliedert ist.
„Wo Selbstzueignung ist, ist keine Wirklichkeit“ – das ist für mich der spannendste Satz des Abschnitts. Selbstzueignung als das Typische der Ich-Es-Situation. Selbstzueignung „verhindert“ vielleicht nicht, dass etwas entsteht. Aber wo sie ist, ist einfach nichts lebendiges. Sie ist so wenig lebendig, dass sie nicht einmal etwas verhindern könnte – quasi ein Vakuum, eben ein Vakuum der „Wirklichkeit.“
Und dann spezifiziert Buber die „zwei Ichs“ im vorletzten Abschnitt sehr passend: wir „haben“ nicht zwei Ichs – wir leben in einem zwiefältigen Ich. Einige von uns leben so sehr in der einen, einige so sehr in der anderen Möglichkeit, dass Buber sie Person oder Eigenwesen bezeichnen würde – aber nicht als zweierlei Menschen(-Typen). In den „Eigenwesen“ wartet dennoch auch das Personische darauf, aufgerufen zu werden. Und ebenfalls sehr spannend: zwischen Eigenwesen-Typen und Personen-Typen trage sich die wahre Geschichte aus.“ Geschichte ist offenkundig nicht „Beziehung“ – aber doch ein sehr wesentliches Ringen.
Dann aber spricht er wieder spannende Beobachtungen oder Thesen aus: Es gibt nicht zweierlei Menschen, aber wohl doch zweierlei Ichs. Beide Ichs, das des Grundworts Ich-Du und das des Ich-Es stecken in allen von uns, beide sind also typischerweise auch gleichzeitig „wirklich“ – aber sie sind auch so etwas wie eine je unterschiedliche Dimension (das ist nicht Bubers Wort). Person und Eigenwesen als Beschreibung dieser unterschiedlichen Fakultäten. Das Ich der Person ist wichtig im bzw. für den Gegenüber, selbst ist es „bedeutungslos.“ Die „Person“ (also die Maske) spielt zwar buchstäbliche eine Rolle. Ihr „Ich“ ist aber „nur“ notwendig für die Beziehung mit der anderen Person/Rolle an die es sich wendet: das was zwischen den Beiden entsteht ist wichtig, die Beziehung – nicht, was hinter ihnen steckt (das ich, jeweils – obgleich zweifellos vorhanden):
Das Ich zum Ich-Es ist hingegen „bedeutungsschwer“ – letztlich hat es aber keinen Gegenüber, weil alles zu diesem ich gehört, Adjektiv darstellt, allenfalls in „meins“ und „nicht meins“ untergliedert ist.
„Wo Selbstzueignung ist, ist keine Wirklichkeit“ – das ist für mich der spannendste Satz des Abschnitts. Selbstzueignung als das Typische der Ich-Es-Situation. Selbstzueignung „verhindert“ vielleicht nicht, dass etwas entsteht. Aber wo sie ist, ist einfach nichts lebendiges. Sie ist so wenig lebendig, dass sie nicht einmal etwas verhindern könnte – quasi ein Vakuum, eben ein Vakuum der „Wirklichkeit.“
Und dann spezifiziert Buber die „zwei Ichs“ im vorletzten Abschnitt sehr passend: wir „haben“ nicht zwei Ichs – wir leben in einem zwiefältigen Ich. Einige von uns leben so sehr in der einen, einige so sehr in der anderen Möglichkeit, dass Buber sie Person oder Eigenwesen bezeichnen würde – aber nicht als zweierlei Menschen(-Typen). In den „Eigenwesen“ wartet dennoch auch das Personische darauf, aufgerufen zu werden. Und ebenfalls sehr spannend: zwischen Eigenwesen-Typen und Personen-Typen trage sich die wahre Geschichte aus.“ Geschichte ist offenkundig nicht „Beziehung“ – aber doch ein sehr wesentliches Ringen.
sehen - 4. Jul, 08:43
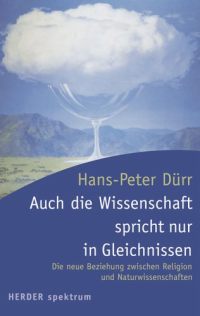
Trackback URL:
https://buber.twoday.net/stories/813225/modTrackback