Teil II Abschnitt 6 – ein Plädoyer gegen die Zwangsläufigkeit oder: das Unbehagen an der Geschichtsschreibung
Teil II Abschnitt 6 – ein Plädoyer gegen die Zwangsläufigkeit oder: das Unbehagen an der Geschichtsschreibung
Buber gibt uns ein weiteres Bild für die Ich-Es-Situation auf der einen, die Ich-Du-Situation auf der anderen Seite. Zur Ich-Es-Situation gehört die monokausale, geradlinige Zwangsläufigkeit. Buber vertieft das mit Bezug auf die Geschichtsschreibung und ähnlich arbeitende, sich selbst ideologisch limitierende, und sich dennoch als Wissenschaft bezeichnende Zugänge zur Welt der Gegenstände: „Alle Ablaufbetrachtung ist nur ein Ordnen des Nichts-als-geworden-Seins, des abgetrennten Geschehnisses, der Gegenständlichkeit als Geschichte.“
Das erinnert mich freudig an Paul Feyerabend: „Wider den Methodenzwang“ oder „Wissenschaft als Kunst,“ in denen Feyerabend unserer heutigen, sich für einzig- und allgemein gültig erklärenden Wissenschaftlichkeit die ideologische Blindheit nachweist.
Mit der (zwangsläufig ex post angesiedelten) Ablaufbetrachtung – die natürlich einen unbestreitbaren Lernwert hat – laufen wir Gefahr sehr viel abzuschneiden: den Geist, wie auch die Alternativen.
Im ersten Teil des Abschnitts versucht Buber zu erklären, was für ihn der fundamentale Unterschied zwischen Schicksal und Verhängnis (oder Zwangsläufigkeit) ist. In der Wahrnehmung der Zwangsläufigkeit führt der Weg stets von A nach B – darum herum oder dazwischen gibt es nichts (typische Ich-Es-Situation). Das ist z.B. die wundersame Welt der Schwerkraft (oder anderer physikalischer Gesetze), die natürlich ihren Erkenntniswert hat, die aber vor allem eine praktische Rechnungsgröße darstellt, die es also erleichtert, zu rechnen. Tatsächlich ergeben schon Experimente mit der Schwerkraft, dass die Dinge nicht unbedingt und nicht genau „nach unten“ fallen, sondern von allen möglichen Faktoren abgelenkt oder auch nur scheinbar abgelenkt werden können. Das existiert wohl genauso bei allen anderen derartig einfachen Versuchen, die Wirklichkeit zu erfassen und wird vom ehrlichen Physiker dann als „Schmutzeffekt“ bezeichnet. Für alle anderen existiert es noch nicht mal. Ich würde umgekehrt sagen, in diesem Sinne besteht die Welt hauptsächlich aus Schmutzeffekten – also aus Verhältnissen, die wir gerade mit keiner Formel vollständig erklären können – auch nicht mit einer Vielzahl von Formeln. Es kommt dann weiter darauf an, was wir wollen: wenn wir rechnen wollen und noch mehr Formeln (darunter stets unbestritten nützliche) entwickeln wollen, dann ist diese Beschäftigung ausreichend. Mit der Einschränkung, dass Buber sie für seelisch krank machend erklärt und dringend eine Kur in der Ich-Du-Situation empfiehlt. Zudem führt die (nahezu) ausschließliche Beschäftigung mit der Ich-Es-Situation nach meiner Beobachtung zu einem zügigen Realitätsverlust: kein Kontakt mehr („you’re out of touch, my baby ...).
Beziehung, die Ich-Du-Situation, bedeutet hingegen gerade diesen Kontakt zur Realität. Darin steckt natürlich eine anmaßende Behauptung. Was ist denn Realität ? Hier meine Erläuterung (wenn auch kein Beweis, ich geb’s zu): Ich bin mir sicher, dass die von Buber sogenannte „uneingeschränkte Ursächlichkeit“ – was ich als geradlinige A-B Kausalitätsbehauptung bezeichnen würde, nur ein sehr schwaches, eingeschränktes Bild davon gibt, wie die Dinge wirklich liegen. Dazu gibt es etwa im eingangs genannten Feld der Geschichtsschreibung viel zu sagen. Ich bin aus den gleichen Beobachtungen heraus, wie oben dargestellt, sicher, dass auch die Addition vieler solcher A-B Kausalitätsbehauptungen (die ergänzenden Formeln), nur eine u.U. bessere Annäherung, aber nie das ganze Bild bringen. Denn die Realität liegt nicht im zwei-dimensionalen (Ich-Es-Situation), auch nicht im unendlich oft addiert zwei-dimensionalen (das ist wohl das Drei-dimensionale, oder ist das schon was völlig anderes ?), mit der vierten Dimension tun wir uns schon relativ schwer – und in der Wirklichkeit schließt die Wirklichkeit alle Dimensionen ein – jedenfalls einige mehr, als wir denken können. Das gesamte, hilfsweise als „sphärische“ denkbare Umfeld, zwischen Apfelbaum, Apfel und Erdboden und alles, was im Flug passiert, was zuvor und währenddessen im Universum passiert - und noch mehr, das ist dieses allumfassende, das einhüllende Zwischen, das die Ich-Du-Situation beschreibt.
Die Monokausalität (A-B), ist die Zwangsläufigkeit, die Ich-Es-Situation, die Unfreiheit – aber auch die Irrealität, weil es sich einfach nicht um ein auch nur annähernd zutreffendes Bild der Wirklichkeit handelt. Es gibt aber auch ein Denken in Alternativen, es gibt die Möglichkeit, den Regeln ihre Allgemeingültigkeit und alles erklärende Kraft abzusprechen – es gibt vor allem die Kraft zur Umkehr.
Schicksal ist dann für Buber etwas völlig anderes als Zwangsläufigkeit: Schicksal, das Universum der Ich-Du-Situation, wird spürbar, wenn ich „die Tat, die mich meint entdecke“ und dann in ihrer Umsetzung merke, „daß ich sie nicht so, wie ich sie meinte, vollbringen kann.“ Und weiter: „Freiheit und Schicksal umfangen einander zum Sinn.“
Buber gibt uns ein weiteres Bild für die Ich-Es-Situation auf der einen, die Ich-Du-Situation auf der anderen Seite. Zur Ich-Es-Situation gehört die monokausale, geradlinige Zwangsläufigkeit. Buber vertieft das mit Bezug auf die Geschichtsschreibung und ähnlich arbeitende, sich selbst ideologisch limitierende, und sich dennoch als Wissenschaft bezeichnende Zugänge zur Welt der Gegenstände: „Alle Ablaufbetrachtung ist nur ein Ordnen des Nichts-als-geworden-Seins, des abgetrennten Geschehnisses, der Gegenständlichkeit als Geschichte.“
Das erinnert mich freudig an Paul Feyerabend: „Wider den Methodenzwang“ oder „Wissenschaft als Kunst,“ in denen Feyerabend unserer heutigen, sich für einzig- und allgemein gültig erklärenden Wissenschaftlichkeit die ideologische Blindheit nachweist.
Mit der (zwangsläufig ex post angesiedelten) Ablaufbetrachtung – die natürlich einen unbestreitbaren Lernwert hat – laufen wir Gefahr sehr viel abzuschneiden: den Geist, wie auch die Alternativen.
Im ersten Teil des Abschnitts versucht Buber zu erklären, was für ihn der fundamentale Unterschied zwischen Schicksal und Verhängnis (oder Zwangsläufigkeit) ist. In der Wahrnehmung der Zwangsläufigkeit führt der Weg stets von A nach B – darum herum oder dazwischen gibt es nichts (typische Ich-Es-Situation). Das ist z.B. die wundersame Welt der Schwerkraft (oder anderer physikalischer Gesetze), die natürlich ihren Erkenntniswert hat, die aber vor allem eine praktische Rechnungsgröße darstellt, die es also erleichtert, zu rechnen. Tatsächlich ergeben schon Experimente mit der Schwerkraft, dass die Dinge nicht unbedingt und nicht genau „nach unten“ fallen, sondern von allen möglichen Faktoren abgelenkt oder auch nur scheinbar abgelenkt werden können. Das existiert wohl genauso bei allen anderen derartig einfachen Versuchen, die Wirklichkeit zu erfassen und wird vom ehrlichen Physiker dann als „Schmutzeffekt“ bezeichnet. Für alle anderen existiert es noch nicht mal. Ich würde umgekehrt sagen, in diesem Sinne besteht die Welt hauptsächlich aus Schmutzeffekten – also aus Verhältnissen, die wir gerade mit keiner Formel vollständig erklären können – auch nicht mit einer Vielzahl von Formeln. Es kommt dann weiter darauf an, was wir wollen: wenn wir rechnen wollen und noch mehr Formeln (darunter stets unbestritten nützliche) entwickeln wollen, dann ist diese Beschäftigung ausreichend. Mit der Einschränkung, dass Buber sie für seelisch krank machend erklärt und dringend eine Kur in der Ich-Du-Situation empfiehlt. Zudem führt die (nahezu) ausschließliche Beschäftigung mit der Ich-Es-Situation nach meiner Beobachtung zu einem zügigen Realitätsverlust: kein Kontakt mehr („you’re out of touch, my baby ...).
Beziehung, die Ich-Du-Situation, bedeutet hingegen gerade diesen Kontakt zur Realität. Darin steckt natürlich eine anmaßende Behauptung. Was ist denn Realität ? Hier meine Erläuterung (wenn auch kein Beweis, ich geb’s zu): Ich bin mir sicher, dass die von Buber sogenannte „uneingeschränkte Ursächlichkeit“ – was ich als geradlinige A-B Kausalitätsbehauptung bezeichnen würde, nur ein sehr schwaches, eingeschränktes Bild davon gibt, wie die Dinge wirklich liegen. Dazu gibt es etwa im eingangs genannten Feld der Geschichtsschreibung viel zu sagen. Ich bin aus den gleichen Beobachtungen heraus, wie oben dargestellt, sicher, dass auch die Addition vieler solcher A-B Kausalitätsbehauptungen (die ergänzenden Formeln), nur eine u.U. bessere Annäherung, aber nie das ganze Bild bringen. Denn die Realität liegt nicht im zwei-dimensionalen (Ich-Es-Situation), auch nicht im unendlich oft addiert zwei-dimensionalen (das ist wohl das Drei-dimensionale, oder ist das schon was völlig anderes ?), mit der vierten Dimension tun wir uns schon relativ schwer – und in der Wirklichkeit schließt die Wirklichkeit alle Dimensionen ein – jedenfalls einige mehr, als wir denken können. Das gesamte, hilfsweise als „sphärische“ denkbare Umfeld, zwischen Apfelbaum, Apfel und Erdboden und alles, was im Flug passiert, was zuvor und währenddessen im Universum passiert - und noch mehr, das ist dieses allumfassende, das einhüllende Zwischen, das die Ich-Du-Situation beschreibt.
Die Monokausalität (A-B), ist die Zwangsläufigkeit, die Ich-Es-Situation, die Unfreiheit – aber auch die Irrealität, weil es sich einfach nicht um ein auch nur annähernd zutreffendes Bild der Wirklichkeit handelt. Es gibt aber auch ein Denken in Alternativen, es gibt die Möglichkeit, den Regeln ihre Allgemeingültigkeit und alles erklärende Kraft abzusprechen – es gibt vor allem die Kraft zur Umkehr.
Schicksal ist dann für Buber etwas völlig anderes als Zwangsläufigkeit: Schicksal, das Universum der Ich-Du-Situation, wird spürbar, wenn ich „die Tat, die mich meint entdecke“ und dann in ihrer Umsetzung merke, „daß ich sie nicht so, wie ich sie meinte, vollbringen kann.“ Und weiter: „Freiheit und Schicksal umfangen einander zum Sinn.“
sehen - 14. Mär, 12:34
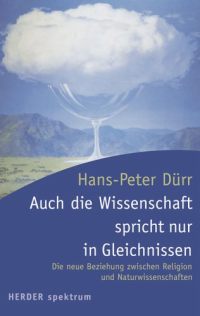
Die Stellen die mir ins Auge, ins Ohr, ins Herz gesprungen sind, sind:
"Der freie Mensch ist der ohne Willkür wollende.
(...)
"Er muss seinen kleinen Willen,
den unfreien, von Dingen und Trieben regierten,
seinem großen opfern,
der vom Bestimmtsein weg und
auf die Bestimmung zu geht.
Da greift er nicht mehr ein,
und er lässt doch auch nicht bloß geschehen.
(...)
"Aber der Freie hat immer wieder nur seinen Entschluss,
auf seine Bestimmung zuzugehen.
(...)
Er glaubt; er begegnet"