Teil II Abschnitt 2 – Geist ist Antwort
Der Geist in seiner menschlichen Kundgebung ist also nicht nur Antwort, sondern wie im Abschnitt zuvor gesehen, etwas, worin der Mensch leben kann.
Der Geist ist nach Buber unabhängig von seiner Ausdrucksform, da letztere Produkt einer doppelten Brechung ist: Geist als Antwort muss sich erst im Menschen formen und dann muss diese Antwort auch noch einen äußeren Ausdruck finden.
Buber meint der Mensch lebt (steht) in der Sprache. Das ist wohl, ebenso wie oben beim Geist, der Hinweis auf die allumfassende, grenzenlose, du-bezogene Eigenschaft der Sprache, wie des Geistes: nicht wie das Blut in Dir, sondern wie die Luft um uns: ein sehr vereinigender Gedanke. Immerhin ist die Luft (wie der Geist ?!) an nationale Grenzen nicht gebunden.
„Der Mensch lebt im Geist, wenn er seinem Du zu antworten vermag ... wenn er in die Beziehung mit seinem ganzen Wesen eintritt.“ Daher also diese doppelte Eigenschaft des Geistes: der Geist ist die Antwort, die Beziehung und daher „alles“ oder allumfassend.
Je deutlicher, klarer, kräftiger aber diese Antwortseite des „Geistes,“ der Ich-Du-Beziehung sind, desto eher wird daraus auch ein sprachlicher Ausdruck – und schon wieder sind wir beim Es. Das „reine“ oder wie Buber besser sagt „freie“ Du steht da, wo der Geist sich nicht kundtut, sondern ist. Das mache das besondere Menschliche aus: dass sich für den Menschen so Erkenntnis, Werk, Bild und Vorbild entwickeln kann – „in der Mitte des Lebendigen“ – und aus ihr heraus... Das sei aber nur die eine Seite des typisch Menschlichen, dem Buber aber schon eine tragische Seite gibt. Die andere Seite sei der inhärente Aufruf, oder die immer bestehende Möglichkeit, vom Es zum Du zurückzukehren: vom Gegenständlichen zur Gegenwart.
Die Basis von Erkenntnis ist im für Buber wohlverstandenen Sinn, das Du-hafte Schauen in einem Es-orientierten Prozess der Erkenntnisvermehrung. Wer danach den „Gegenstand“ aus der begrifflichen Erkenntnis wieder herausnehmen kann, hat die Möglichkeit wieder ich das Ich-Du, also in die Gegenwart, einzutreten.
Und zum Schluss führt Buber noch das „reine Wirken, die Handlung ohne Willkür“ als höchste Ausdrucksform des Geistes ein: Die Antwort mit dem Leben. Das sein Leben sprechen lassen. Dieses Leben sei Lehre. Nicht Lehre darüber, was ist und was sein soll, sondern wie im Geist, im Angesicht des Du gelebt wird. Das führt also zurück zur Beziehungskraft, die laut Abschnitt 1 heute (bzw. vor 80 Jahren) so sehr gemindert sei.
Aha. Buber sagt, er habe keine Lehre. Vielleicht sollten wir uns doch sein Leben ansehen, soviel wir hinter den Schriften davon als Antwort auf den Geist finden können.
Dieses Leben – das erlebte Leben – ist dann möglicherweise Schlüssel zum Du und kann auch selbst zum Du werden. Wer „Bescheid weiss,“ die Welt erobert hat, alles im Buch gelesen hat, verfehlt so das Du. Verehrung und Anbetung ist etwas völlig anderes, als sich anrühren zu lassen – umfassend anrühren zu lassen.
Der Geist ist nach Buber unabhängig von seiner Ausdrucksform, da letztere Produkt einer doppelten Brechung ist: Geist als Antwort muss sich erst im Menschen formen und dann muss diese Antwort auch noch einen äußeren Ausdruck finden.
Buber meint der Mensch lebt (steht) in der Sprache. Das ist wohl, ebenso wie oben beim Geist, der Hinweis auf die allumfassende, grenzenlose, du-bezogene Eigenschaft der Sprache, wie des Geistes: nicht wie das Blut in Dir, sondern wie die Luft um uns: ein sehr vereinigender Gedanke. Immerhin ist die Luft (wie der Geist ?!) an nationale Grenzen nicht gebunden.
„Der Mensch lebt im Geist, wenn er seinem Du zu antworten vermag ... wenn er in die Beziehung mit seinem ganzen Wesen eintritt.“ Daher also diese doppelte Eigenschaft des Geistes: der Geist ist die Antwort, die Beziehung und daher „alles“ oder allumfassend.
Je deutlicher, klarer, kräftiger aber diese Antwortseite des „Geistes,“ der Ich-Du-Beziehung sind, desto eher wird daraus auch ein sprachlicher Ausdruck – und schon wieder sind wir beim Es. Das „reine“ oder wie Buber besser sagt „freie“ Du steht da, wo der Geist sich nicht kundtut, sondern ist. Das mache das besondere Menschliche aus: dass sich für den Menschen so Erkenntnis, Werk, Bild und Vorbild entwickeln kann – „in der Mitte des Lebendigen“ – und aus ihr heraus... Das sei aber nur die eine Seite des typisch Menschlichen, dem Buber aber schon eine tragische Seite gibt. Die andere Seite sei der inhärente Aufruf, oder die immer bestehende Möglichkeit, vom Es zum Du zurückzukehren: vom Gegenständlichen zur Gegenwart.
Die Basis von Erkenntnis ist im für Buber wohlverstandenen Sinn, das Du-hafte Schauen in einem Es-orientierten Prozess der Erkenntnisvermehrung. Wer danach den „Gegenstand“ aus der begrifflichen Erkenntnis wieder herausnehmen kann, hat die Möglichkeit wieder ich das Ich-Du, also in die Gegenwart, einzutreten.
Und zum Schluss führt Buber noch das „reine Wirken, die Handlung ohne Willkür“ als höchste Ausdrucksform des Geistes ein: Die Antwort mit dem Leben. Das sein Leben sprechen lassen. Dieses Leben sei Lehre. Nicht Lehre darüber, was ist und was sein soll, sondern wie im Geist, im Angesicht des Du gelebt wird. Das führt also zurück zur Beziehungskraft, die laut Abschnitt 1 heute (bzw. vor 80 Jahren) so sehr gemindert sei.
Aha. Buber sagt, er habe keine Lehre. Vielleicht sollten wir uns doch sein Leben ansehen, soviel wir hinter den Schriften davon als Antwort auf den Geist finden können.
Dieses Leben – das erlebte Leben – ist dann möglicherweise Schlüssel zum Du und kann auch selbst zum Du werden. Wer „Bescheid weiss,“ die Welt erobert hat, alles im Buch gelesen hat, verfehlt so das Du. Verehrung und Anbetung ist etwas völlig anderes, als sich anrühren zu lassen – umfassend anrühren zu lassen.
sehen - 3. Mär, 08:46
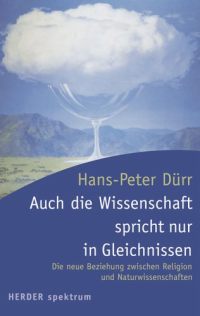
Nun will ich mit Eurem Maß mitlesen.
Teil II, Ende des zweiten Abschnitts:
„O einsames Angesicht sternhaft im Dunkel, o lebendiger Finger auf einer unempfindlichen Stirn, o verhallender Schritt!“ Hier mußte ich schmunzeln: Mochte Martin Buber Georg Trakl? – Wieder eine Frage nach Bubers Leben …
Willkommen auf heimischem Terrain
Horch (Audi ?), Du kannst dieses Blog abonnieren (Mitglied werden) - dann kann ich Dich auch zum "Kontributor" machen. Du bist dann eingeladen auch gleich über Teil III Abschnitt 9 oder einen ganz anderen Text zu schreiben. Die Reihenfolge ist wirklich egal. Es geht also nicht um "unser Maß," sondern, dass ich für mich diese Art der Lese- und Antwortweise als passend entdeckt habe. Dieses Blog gibt aber Raum, auch darüber hinaus zu gehen. Jede kann jeder und allem an jeder Stelle antworten - wenn es so sein soll ... Oder mehr von Levinas berichten. Ich denke, es gibt noch sehr viele, die auf das gleiche geantwortet haben. Wir sind dicht dran :-)
schon II.3 ??!!
Kaum dreht man dem blogg den Rücken zu (Redaktionsschluss - puh-geschafft) ist schon ein neuer drin, horch, horch...
Witzig finde ich es, gerade die Stelle mit der Stirn hier zu finden. Beim Lesen markiere ich mir die Stellen im Buch, die ich für mich als sehr erhellend finde (und demnach auch verstehe). Und dann gibt es immer wieder Stellen, mit denen ich gar nix anfagen kann. Und dazu gehörte heute das mit dem Dunkel, der Stirn und dem Schritt.
Würde mir das mal jemand erklären?
Gruß !
Ideen Teil II Abschnitt 2
Also meine Ideen zu dem letzten Satz von Teil II Abschnitt 2:
Buber beschreibt zuvor eine äußerst unbefriedigende („unerlöste“) Situation, die er noch dazu als umsichgreifend wahrnimmt. Nun könnte er mit einem wehklagenden „Oh Je...“ oder „Oh Gott“ enden. Das liegt ihm natürlich völlig fern. Der extremen Ich-Es-Situation setzt er aber eine Du-Erfahrung gegenüber. Sehr fassbar, bildhaft, geradezu zitatartig. Natürlich gibt es diese Schöpfungs- bzw. Seelenvermittlungsszene mit dem Finger auf der Stirn. In den Bildern ist die Anwesenheit des DU zu spüren, aber auch, wie sie entschwindet – und angerufen werden muss, um den Bezug nicht zu verlieren. Ist das hilfreich ? Eine schöne Woche !
O einsames Angesicht sternhaft im Dunkel - und der Finger auf unempfindlicher Stirn.
Ich denke so: 12 Zeilen weiter oben schreibt Buber: Das Leben "steht bereit, ihnen allzeit selbst zum Du zu werden und die Duwelt aufzutun; nein, es steht nicht bereit, es kommt immerdar auf sie zu und rührt sie an." Diesem Wunder des unverdienten Auf-mich-Zukommens des Lebens, um mir "Du" zu werden - dieser Gnade gibt er schließlich die Form einer fast stammelnden Lobpreisung. Ich kann das verstehen. (Erinnert das nicht auch an Eckehart, der sagt, daß es Gottes Wesen sei, unentwegt auf uns zuzugehen?)
Meine Freude an dieser Stelle rührte eigentlich nicht von einem konkreten Verstehen her. Es ist mehr der Duktus von Trakl, der mich Schmunzeln machte.
Für den Fall, daß Dir Georg Trakl nicht gegenwärtig sein sollte, hier ein Zitat aus „Erinnerung“, bei dem es rein um die sprachliche Form geht:
O dein Lächeln im Dunkel, traurig und böse, daß ein Kind im Schlaf erbleicht. Eine rote Flamme sprang aus deiner Hand und ein Nachfalter verbrannte daran. O die Flöte des Lichts; o die Flöte des Tods. Was zwang dich still zu stehen auf verfallener Stiege, im Haus deiner Väter? Drunten ans Tor klopft ein Engel mit kristallnem Finger. O die Hölle des Schlafs; dunkle Gasse, braunes Gärtchen. Leise läutet im blauen Abend der Toten Gestalt. Grüne Blümchen umgaukeln sie und ihr Antlitz hat sie verlassen. Oder es neigt sich verblichen über die kalte Stirne des Mörders im Dunkel des Hausflurs; Anbetung, purpurne Flamme der Wollust; hinsterbend stürzte über schwarze Stufen der Schläfer ins Dunkel.