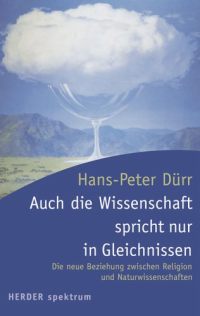Teil II Abschnitt 2 – Geist ist Antwort
Der Geist in seiner menschlichen Kundgebung ist also nicht nur Antwort, sondern wie im Abschnitt zuvor gesehen, etwas, worin der Mensch leben kann.
Der Geist ist nach Buber unabhängig von seiner Ausdrucksform, da letztere Produkt einer doppelten Brechung ist: Geist als Antwort muss sich erst im Menschen formen und dann muss diese Antwort auch noch einen äußeren Ausdruck finden.
Buber meint der Mensch lebt (steht) in der Sprache. Das ist wohl, ebenso wie oben beim Geist, der Hinweis auf die allumfassende, grenzenlose, du-bezogene Eigenschaft der Sprache, wie des Geistes: nicht wie das Blut in Dir, sondern wie die Luft um uns: ein sehr vereinigender Gedanke. Immerhin ist die Luft (wie der Geist ?!) an nationale Grenzen nicht gebunden.
„Der Mensch lebt im Geist, wenn er seinem Du zu antworten vermag ... wenn er in die Beziehung mit seinem ganzen Wesen eintritt.“ Daher also diese doppelte Eigenschaft des Geistes: der Geist ist die Antwort, die Beziehung und daher „alles“ oder allumfassend.
Je deutlicher, klarer, kräftiger aber diese Antwortseite des „Geistes,“ der Ich-Du-Beziehung sind, desto eher wird daraus auch ein sprachlicher Ausdruck – und schon wieder sind wir beim Es. Das „reine“ oder wie Buber besser sagt „freie“ Du steht da, wo der Geist sich nicht kundtut, sondern ist. Das mache das besondere Menschliche aus: dass sich für den Menschen so Erkenntnis, Werk, Bild und Vorbild entwickeln kann – „in der Mitte des Lebendigen“ – und aus ihr heraus... Das sei aber nur die eine Seite des typisch Menschlichen, dem Buber aber schon eine tragische Seite gibt. Die andere Seite sei der inhärente Aufruf, oder die immer bestehende Möglichkeit, vom Es zum Du zurückzukehren: vom Gegenständlichen zur Gegenwart.
Die Basis von Erkenntnis ist im für Buber wohlverstandenen Sinn, das Du-hafte Schauen in einem Es-orientierten Prozess der Erkenntnisvermehrung. Wer danach den „Gegenstand“ aus der begrifflichen Erkenntnis wieder herausnehmen kann, hat die Möglichkeit wieder ich das Ich-Du, also in die Gegenwart, einzutreten.
Und zum Schluss führt Buber noch das „reine Wirken, die Handlung ohne Willkür“ als höchste Ausdrucksform des Geistes ein: Die Antwort mit dem Leben. Das sein Leben sprechen lassen. Dieses Leben sei Lehre. Nicht Lehre darüber, was ist und was sein soll, sondern wie im Geist, im Angesicht des Du gelebt wird. Das führt also zurück zur Beziehungskraft, die laut Abschnitt 1 heute (bzw. vor 80 Jahren) so sehr gemindert sei.
Aha. Buber sagt, er habe keine Lehre. Vielleicht sollten wir uns doch sein Leben ansehen, soviel wir hinter den Schriften davon als Antwort auf den Geist finden können.
Dieses Leben – das erlebte Leben – ist dann möglicherweise Schlüssel zum Du und kann auch selbst zum Du werden. Wer „Bescheid weiss,“ die Welt erobert hat, alles im Buch gelesen hat, verfehlt so das Du. Verehrung und Anbetung ist etwas völlig anderes, als sich anrühren zu lassen – umfassend anrühren zu lassen.
Der Geist ist nach Buber unabhängig von seiner Ausdrucksform, da letztere Produkt einer doppelten Brechung ist: Geist als Antwort muss sich erst im Menschen formen und dann muss diese Antwort auch noch einen äußeren Ausdruck finden.
Buber meint der Mensch lebt (steht) in der Sprache. Das ist wohl, ebenso wie oben beim Geist, der Hinweis auf die allumfassende, grenzenlose, du-bezogene Eigenschaft der Sprache, wie des Geistes: nicht wie das Blut in Dir, sondern wie die Luft um uns: ein sehr vereinigender Gedanke. Immerhin ist die Luft (wie der Geist ?!) an nationale Grenzen nicht gebunden.
„Der Mensch lebt im Geist, wenn er seinem Du zu antworten vermag ... wenn er in die Beziehung mit seinem ganzen Wesen eintritt.“ Daher also diese doppelte Eigenschaft des Geistes: der Geist ist die Antwort, die Beziehung und daher „alles“ oder allumfassend.
Je deutlicher, klarer, kräftiger aber diese Antwortseite des „Geistes,“ der Ich-Du-Beziehung sind, desto eher wird daraus auch ein sprachlicher Ausdruck – und schon wieder sind wir beim Es. Das „reine“ oder wie Buber besser sagt „freie“ Du steht da, wo der Geist sich nicht kundtut, sondern ist. Das mache das besondere Menschliche aus: dass sich für den Menschen so Erkenntnis, Werk, Bild und Vorbild entwickeln kann – „in der Mitte des Lebendigen“ – und aus ihr heraus... Das sei aber nur die eine Seite des typisch Menschlichen, dem Buber aber schon eine tragische Seite gibt. Die andere Seite sei der inhärente Aufruf, oder die immer bestehende Möglichkeit, vom Es zum Du zurückzukehren: vom Gegenständlichen zur Gegenwart.
Die Basis von Erkenntnis ist im für Buber wohlverstandenen Sinn, das Du-hafte Schauen in einem Es-orientierten Prozess der Erkenntnisvermehrung. Wer danach den „Gegenstand“ aus der begrifflichen Erkenntnis wieder herausnehmen kann, hat die Möglichkeit wieder ich das Ich-Du, also in die Gegenwart, einzutreten.
Und zum Schluss führt Buber noch das „reine Wirken, die Handlung ohne Willkür“ als höchste Ausdrucksform des Geistes ein: Die Antwort mit dem Leben. Das sein Leben sprechen lassen. Dieses Leben sei Lehre. Nicht Lehre darüber, was ist und was sein soll, sondern wie im Geist, im Angesicht des Du gelebt wird. Das führt also zurück zur Beziehungskraft, die laut Abschnitt 1 heute (bzw. vor 80 Jahren) so sehr gemindert sei.
Aha. Buber sagt, er habe keine Lehre. Vielleicht sollten wir uns doch sein Leben ansehen, soviel wir hinter den Schriften davon als Antwort auf den Geist finden können.
Dieses Leben – das erlebte Leben – ist dann möglicherweise Schlüssel zum Du und kann auch selbst zum Du werden. Wer „Bescheid weiss,“ die Welt erobert hat, alles im Buch gelesen hat, verfehlt so das Du. Verehrung und Anbetung ist etwas völlig anderes, als sich anrühren zu lassen – umfassend anrühren zu lassen.
sehen - 3. Mär, 08:46