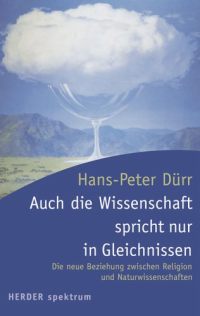Teil II Abschnitt 1 - „Entwicklung des geistigen Lebens“ eine Sprachsünde ?
Dieser Abschnitt endet mit einer Behauptung, in der Du, mimi23, wohl schon die deutliche Bevorzugung des Ich-Du gegenüber dem Ich-Es siehst: „Denn die Ausbildung der erfahrenden und gebrauchenden Fähigkeiten erfolgt zumeist durch Minderung der Beziehungskraft des Menschen – der Kraft, vermöge deren allein der Mensch im Geist leben kann.“
Das bleibt zunächst reine Behauptung. Wir haben zwar vielleicht das Gefühl, dass das stimmen könnte. Vielleicht wird Buber das auch in den weiteren Abschnitten von Teil II erläutern. Nach dem in Abschnitt I gelesenen kann ich das bisher nur so verstehen, dass die in der Welt der Gegenstände erworbenen Fähigkeiten dazu führen, dass wir uns in dieser Welt immer besser einrichten können und immer weniger Neigung verspüren, uns auf die Ich-Du-Möglichkeit einzulassen. So wie Buber im letzten Abschnitt von Teil I schreibt: „In bloßer Gegenwart läßt sich nicht leben ... Aber in bloßer Vergangenheit läßt sich leben, ja nur in ihr läßt sich ein Leben einrichten.“ Dieses „Einrichten“ eine typische Ausprägung der Ich-Es-Situation.
Übrigens ein paralleles Gefühl drückt wohl Fromm in „Haben oder Sein“ aus.
Wenn wir aber kritisch an Bubers Behauptung weiterdenken, werden wir prüfen müssen, was er mit „Beziehungskraft“ (der Kraft, vermöge deren allein ...) und was er mit „im Geist leben“ meint.
Im übrigen ist sich Buber bewußt gewesen, dass seine Untzerscheidung zwischen Du und Es (Sein und Haben) vielleicht etwas schwarz weiss ist. Er soll das aber mit der Erklärung gerechtfertigt haben, in einer Zeit in der das haben bestimmend sei, habe er die Aufgabe, den Primat des dialogischen Seins verstärkt und damit eben einseitig herauszustellen.
Das bleibt zunächst reine Behauptung. Wir haben zwar vielleicht das Gefühl, dass das stimmen könnte. Vielleicht wird Buber das auch in den weiteren Abschnitten von Teil II erläutern. Nach dem in Abschnitt I gelesenen kann ich das bisher nur so verstehen, dass die in der Welt der Gegenstände erworbenen Fähigkeiten dazu führen, dass wir uns in dieser Welt immer besser einrichten können und immer weniger Neigung verspüren, uns auf die Ich-Du-Möglichkeit einzulassen. So wie Buber im letzten Abschnitt von Teil I schreibt: „In bloßer Gegenwart läßt sich nicht leben ... Aber in bloßer Vergangenheit läßt sich leben, ja nur in ihr läßt sich ein Leben einrichten.“ Dieses „Einrichten“ eine typische Ausprägung der Ich-Es-Situation.
Übrigens ein paralleles Gefühl drückt wohl Fromm in „Haben oder Sein“ aus.
Wenn wir aber kritisch an Bubers Behauptung weiterdenken, werden wir prüfen müssen, was er mit „Beziehungskraft“ (der Kraft, vermöge deren allein ...) und was er mit „im Geist leben“ meint.
Im übrigen ist sich Buber bewußt gewesen, dass seine Untzerscheidung zwischen Du und Es (Sein und Haben) vielleicht etwas schwarz weiss ist. Er soll das aber mit der Erklärung gerechtfertigt haben, in einer Zeit in der das haben bestimmend sei, habe er die Aufgabe, den Primat des dialogischen Seins verstärkt und damit eben einseitig herauszustellen.
sehen - 2. Mär, 08:02