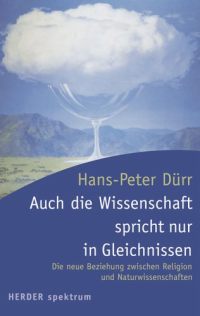Teil I Abschnitt 23 - Zuviel Gegenstand schadet der Beziehung ?
Oh je, hier wird es komplex. Beziehung, so meint Buber, sei frueher als gegenstand. Das hatte er schon individual-entwicklungsgeschichtlich erklaert, jetzt erklaert er es sozial-anthropologisch. Beginnend mit dem all-umfassenden getragen sein, wird erst das erleben der wirkung bewusst, dann wird es von einem selbst abgetrennt und auf ein Objekt
uebertragen, das dann mit mannigfaltigen eigenschaften ausgestattet werden kann und gegenstand von wissen wird. Das sei ein vorgang, der sich aus dem erregungsbild ergibt, das die beziehung hervorruft. In diesem erregungbild ist die „wirkung“ das, was fuer den erhaltungstrieb das wichtigste und fuer den erkenntnistrieb das merkwuerdigste sei.
Daher sei es nicht „alles,“ etwas, das spuren hinterlaesst, sondern
gerade die „wirkung.“ Das bedeutet fuer uns, dass beziehung nicht haupsaechlich durch ihre wirkung charakterisiert wird. Wir koennen aber am ehesten die wirkung „unterscheiden“ und befinden uns damit natuerlich sofort wieder aus der welt der ich-du beziehung heraus in die welt der ich-er/sie/es-beziehung. Erst aus vieles solchen begegnungen, in denen aus dem du mit seinen unendlich vielen gestalten ein er/sie/es mit seinen typen wird, entsteht auch das ich, als der „gleichbleibende“ partner der wechselnden beziehungen. Buber spricht von gleichbleibend. Ich meine, dass das ein relatives gleichbleiben ist. Nach dem, was wir wissen, wird das ich doch in der du beziehung immer wieder so stark gepraegt, dass es sich nicht um ein gleichbleibendes handeln ich kann. Ich glaub, letztlich so aehnlich auch in den anderen beziehungen, nur eben in geringerem masse.
Zum urspruenglichen Selbst-Erhaltungstrieb, zur Schoepfung und
Fortpflanzung gehoert nach Buber kein Ich, sondern ein Er/sie/es. Was die spannende Frage gibt, ob es nicht auch viele Beziehungen von er/sie/es zu er/sie/es geben muss – oder hab ich da was falsch verstanden ?
uebertragen, das dann mit mannigfaltigen eigenschaften ausgestattet werden kann und gegenstand von wissen wird. Das sei ein vorgang, der sich aus dem erregungsbild ergibt, das die beziehung hervorruft. In diesem erregungbild ist die „wirkung“ das, was fuer den erhaltungstrieb das wichtigste und fuer den erkenntnistrieb das merkwuerdigste sei.
Daher sei es nicht „alles,“ etwas, das spuren hinterlaesst, sondern
gerade die „wirkung.“ Das bedeutet fuer uns, dass beziehung nicht haupsaechlich durch ihre wirkung charakterisiert wird. Wir koennen aber am ehesten die wirkung „unterscheiden“ und befinden uns damit natuerlich sofort wieder aus der welt der ich-du beziehung heraus in die welt der ich-er/sie/es-beziehung. Erst aus vieles solchen begegnungen, in denen aus dem du mit seinen unendlich vielen gestalten ein er/sie/es mit seinen typen wird, entsteht auch das ich, als der „gleichbleibende“ partner der wechselnden beziehungen. Buber spricht von gleichbleibend. Ich meine, dass das ein relatives gleichbleiben ist. Nach dem, was wir wissen, wird das ich doch in der du beziehung immer wieder so stark gepraegt, dass es sich nicht um ein gleichbleibendes handeln ich kann. Ich glaub, letztlich so aehnlich auch in den anderen beziehungen, nur eben in geringerem masse.
Zum urspruenglichen Selbst-Erhaltungstrieb, zur Schoepfung und
Fortpflanzung gehoert nach Buber kein Ich, sondern ein Er/sie/es. Was die spannende Frage gibt, ob es nicht auch viele Beziehungen von er/sie/es zu er/sie/es geben muss – oder hab ich da was falsch verstanden ?
sehen - 11. Feb, 12:52